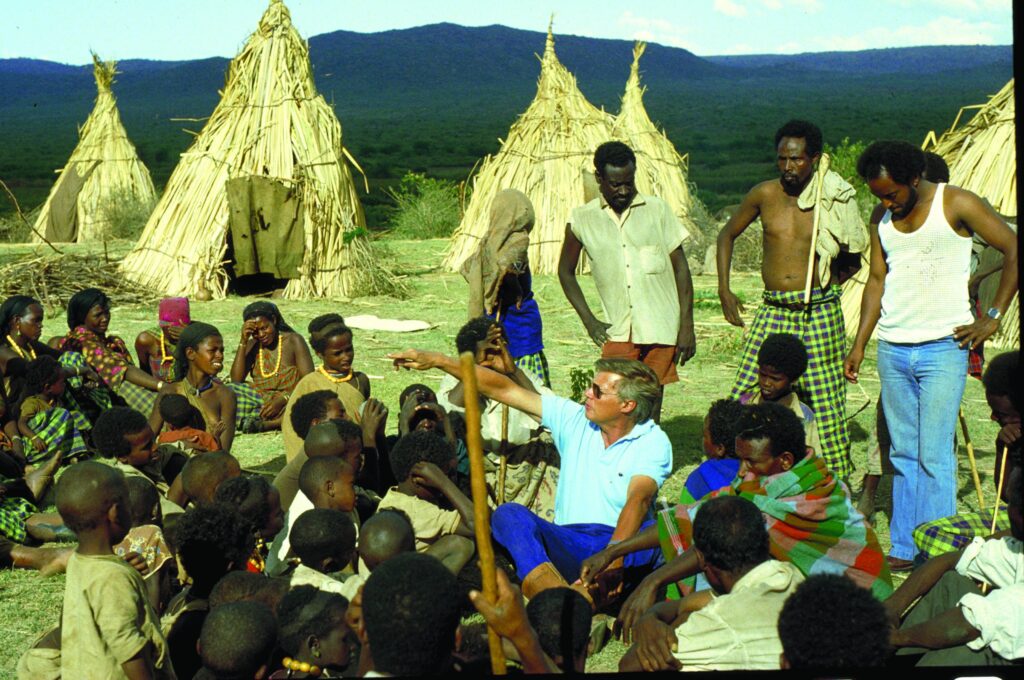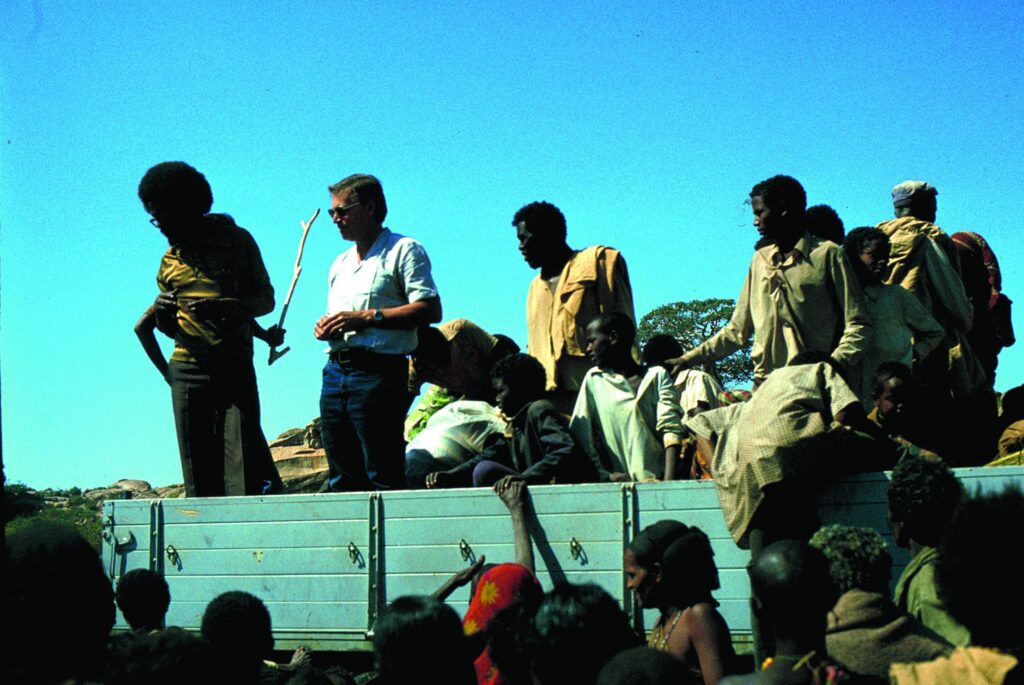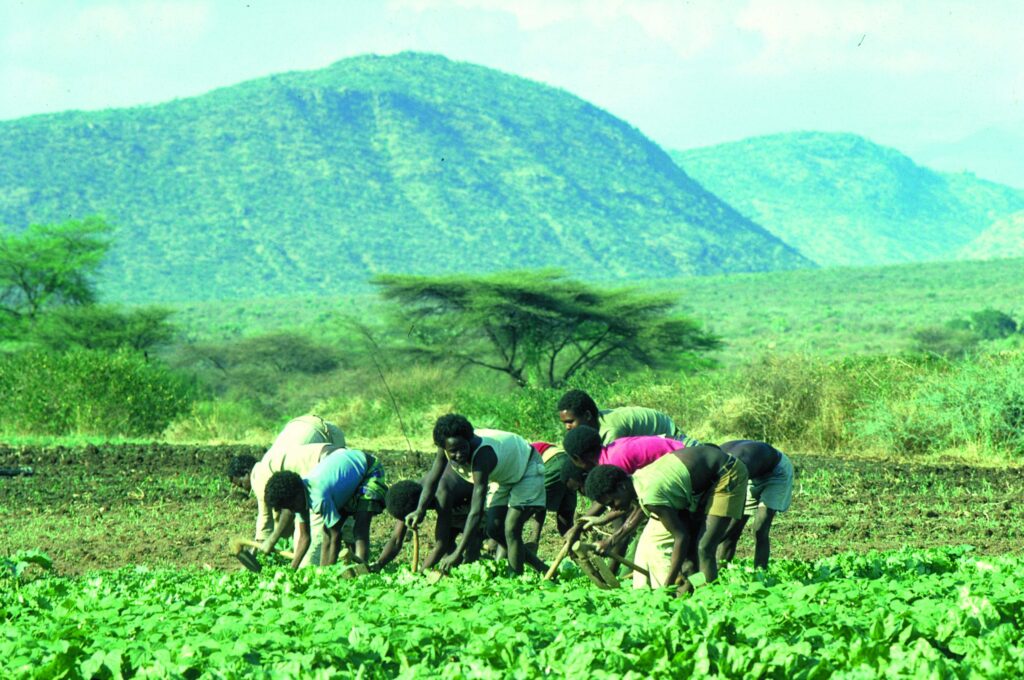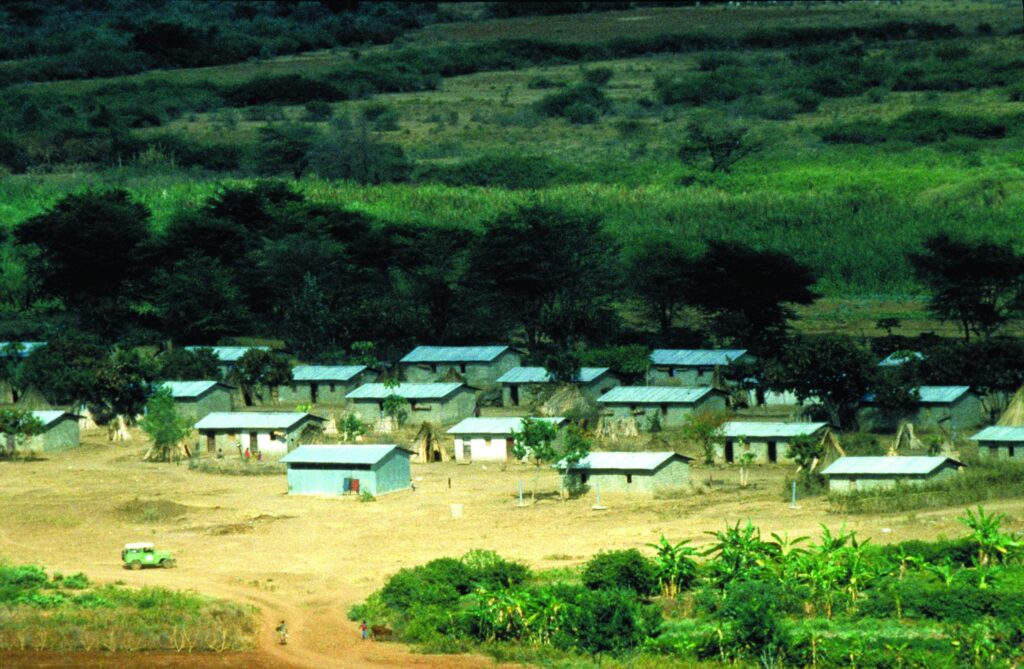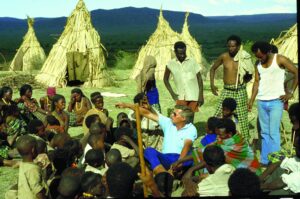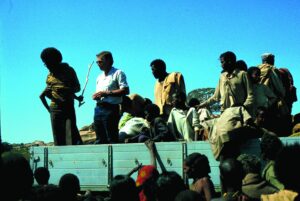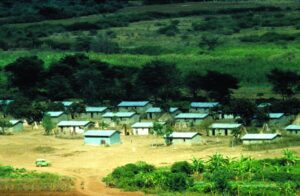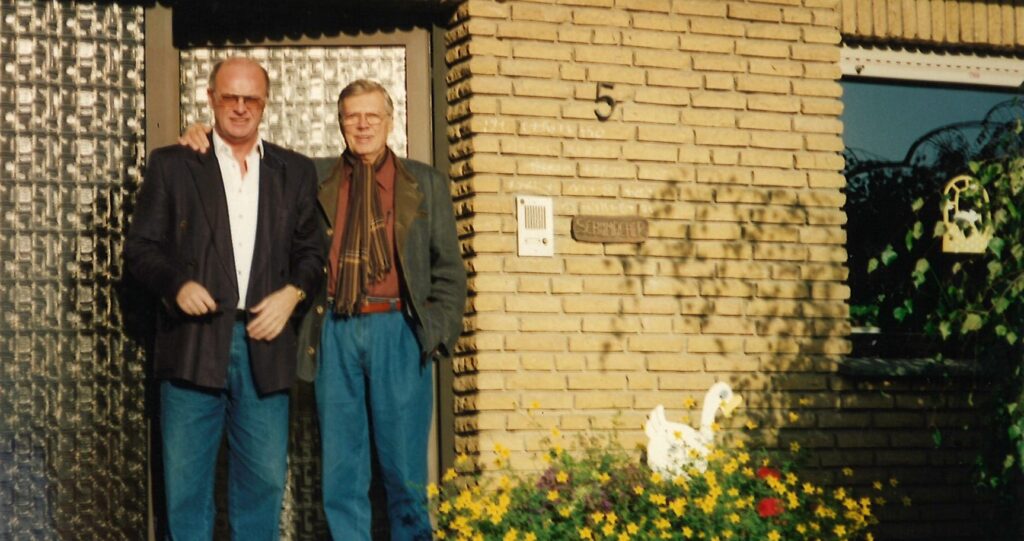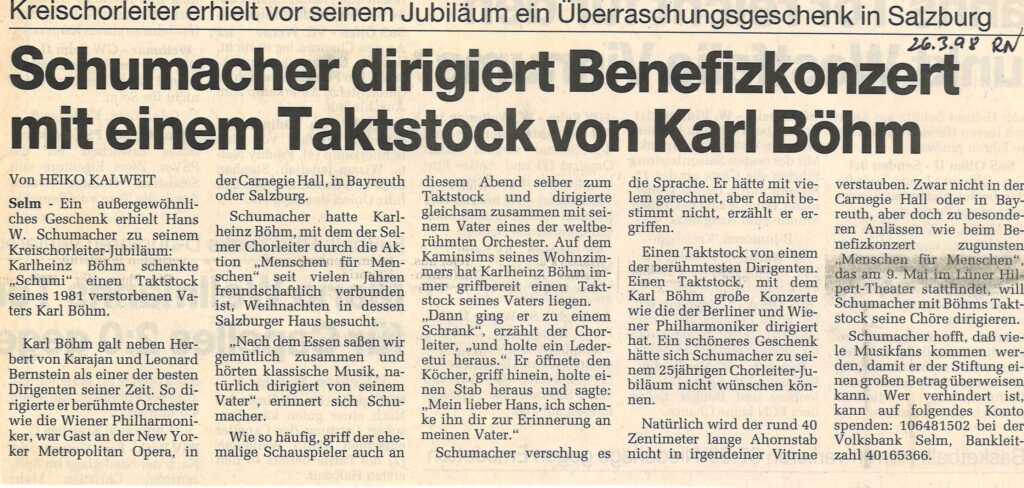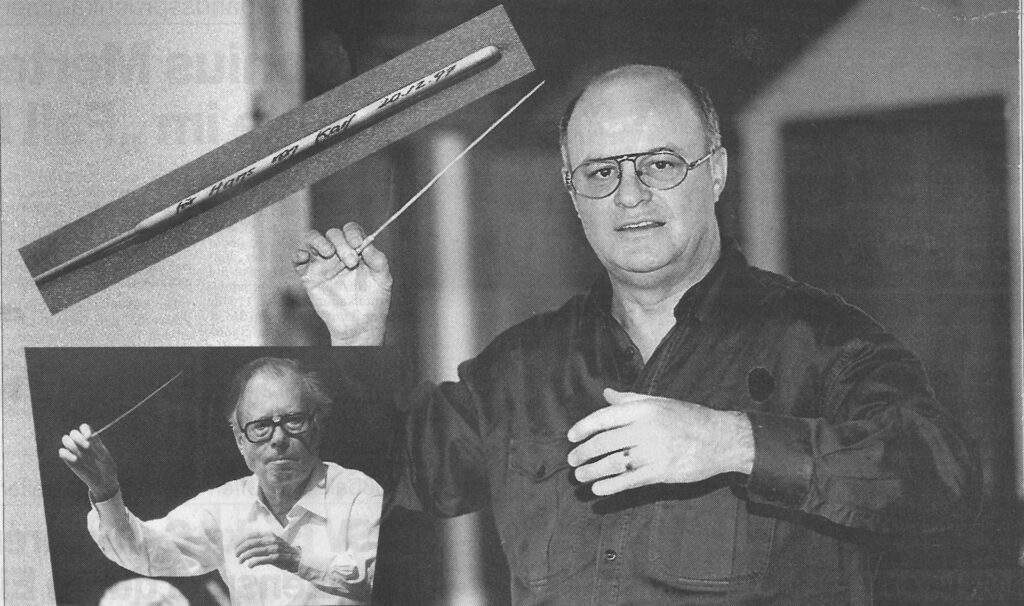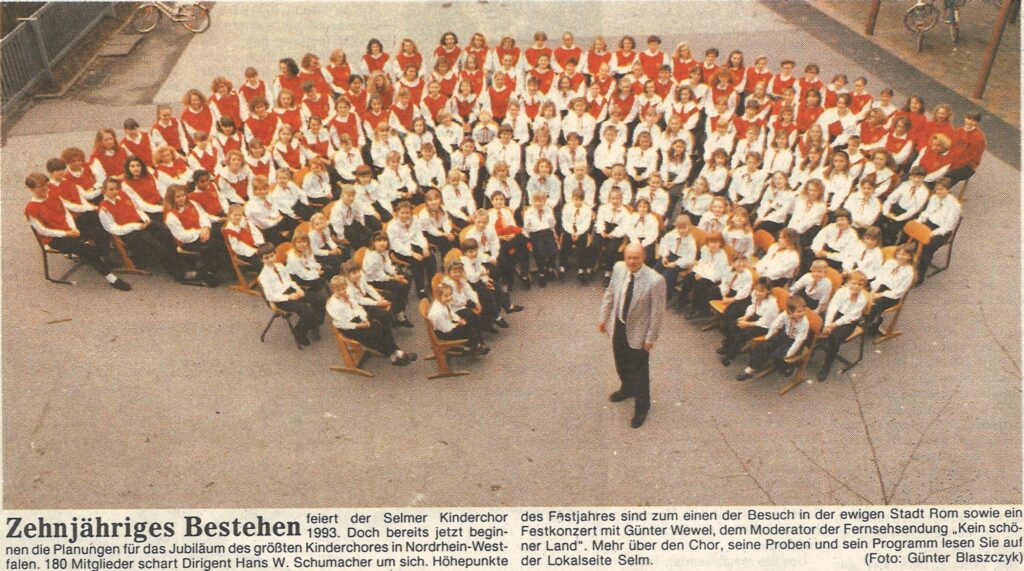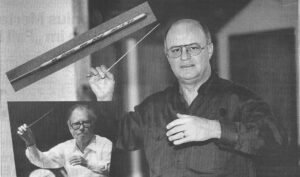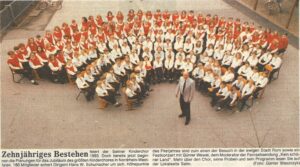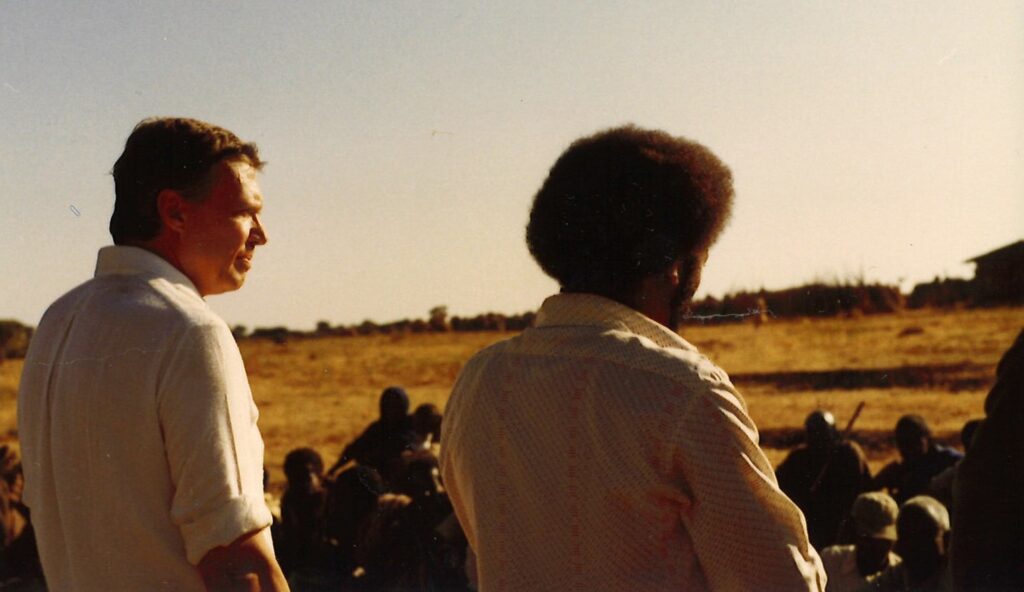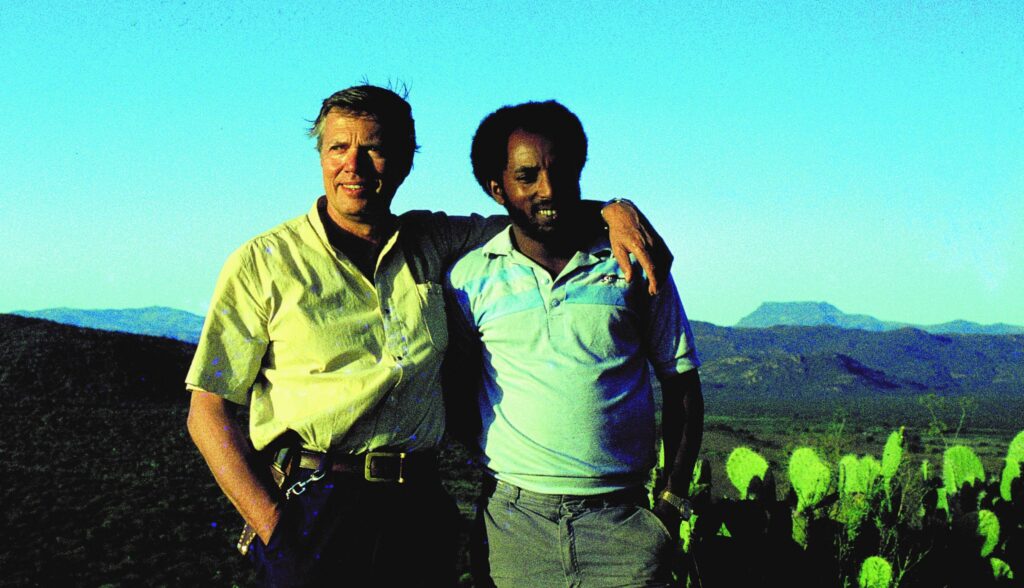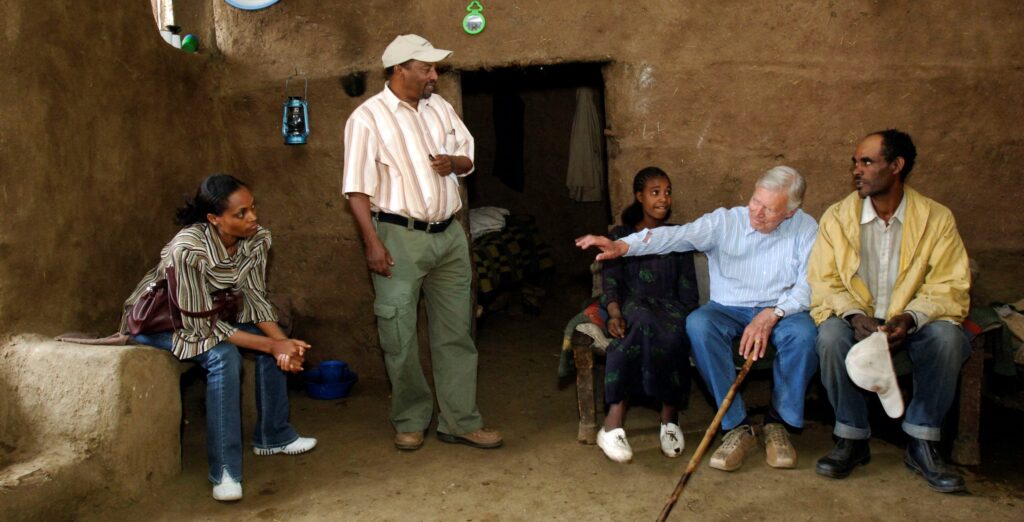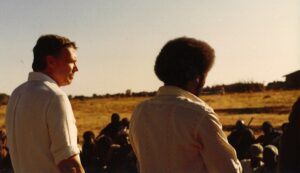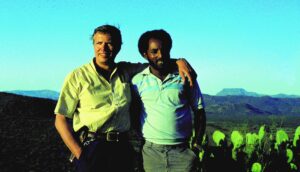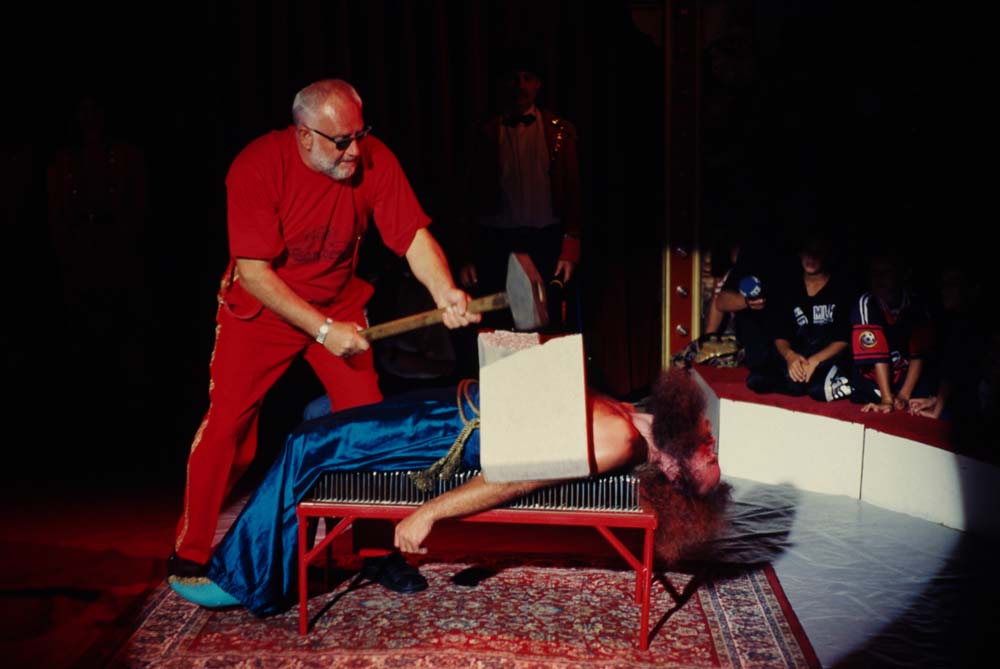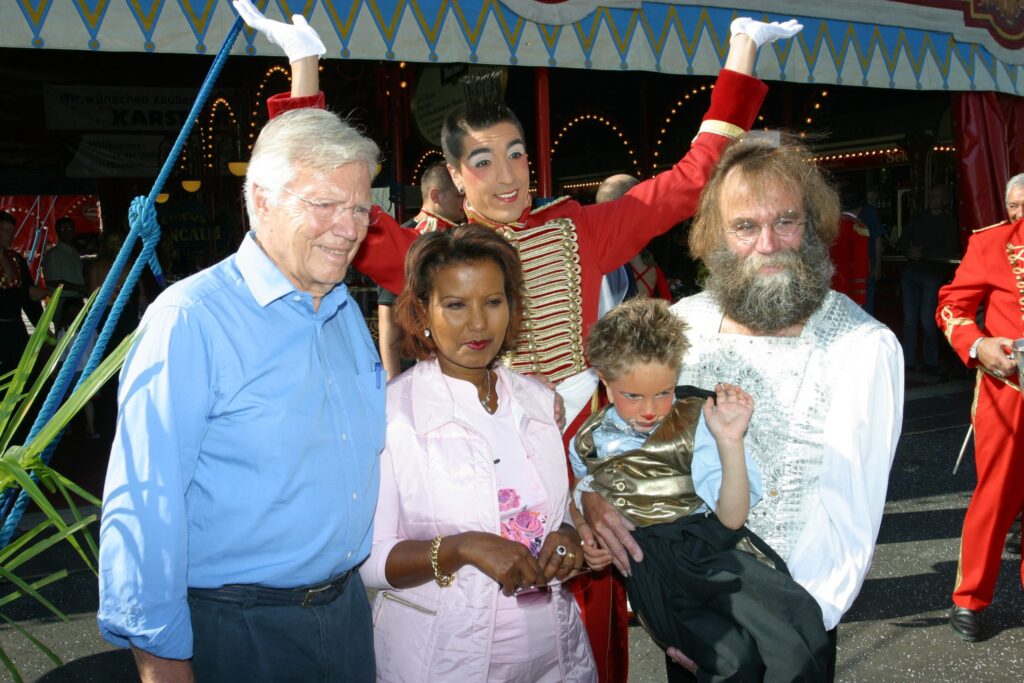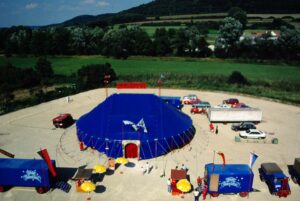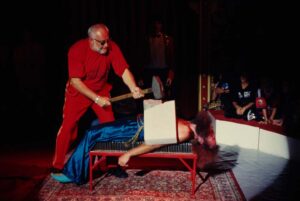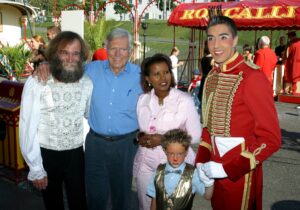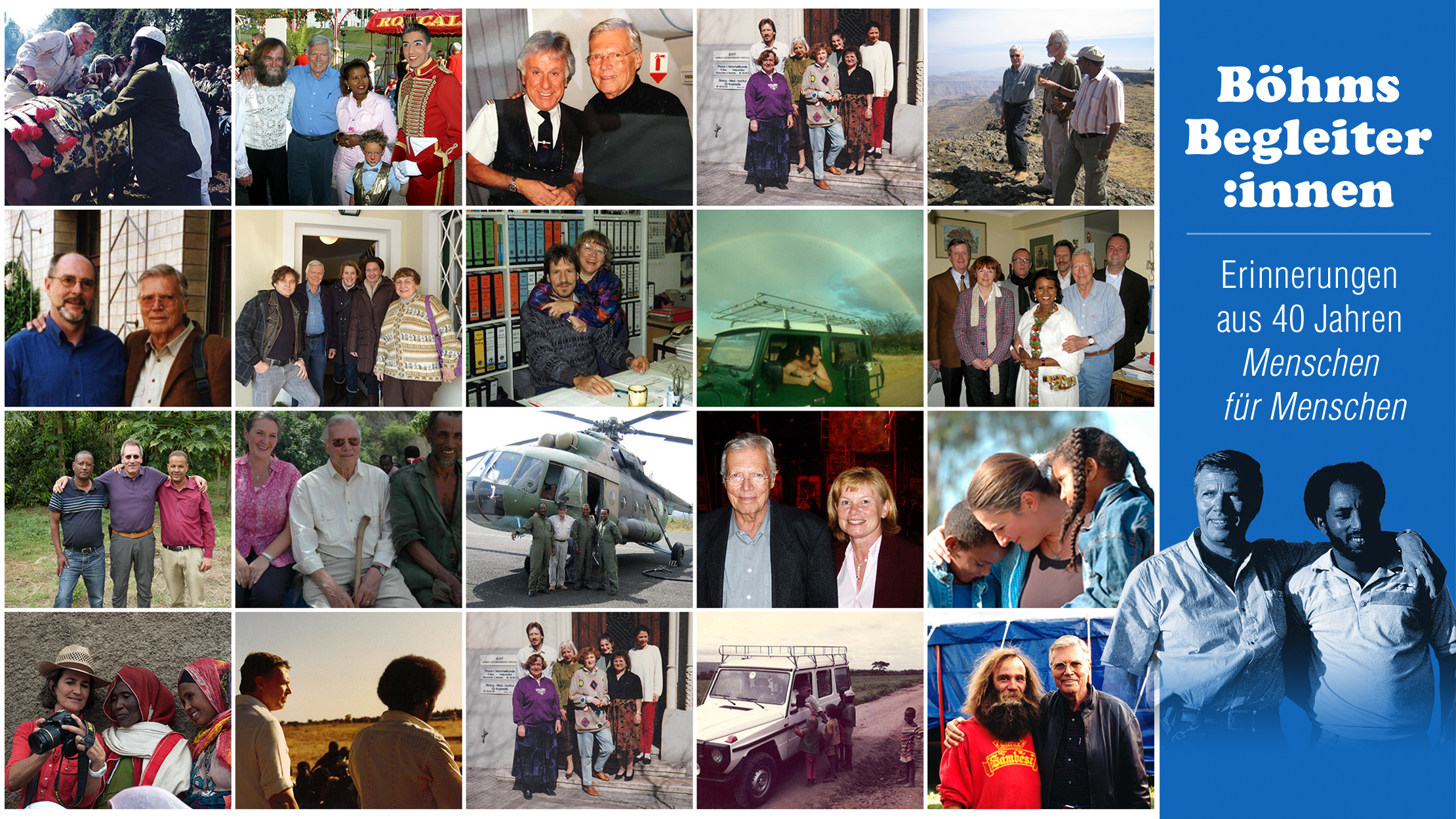
Böhms Begleiter:innen
Sechs Millionen Menschen profitieren bis heute von der Arbeit von Menschen für Menschen. Von den 458 Schulen, die bislang gebaut wurden. Von den 2.685 Wasserstellen oder den 106 Gesundheitsstationen. Wer aber sind eigentlich die Menschen hinter diesen ganzen Zahlen?
Natürlich, da ist zuvorderst Karlheinz Böhm, der Gründer und das Gesicht von Menschen für Menschen, der der Stiftung 30 Jahre lang vorstand. Da sind aber auch viele kleine und große Zahnrädchen, deren Ineinandergreifen den Erfolg von Menschen für Menschen überhaupt erst möglich gemacht haben: Karlheinz Böhms Begleiterinnen und Begleiter über die vergangenen vier Jahrzehnte.
Hinter den Kulissen von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe
Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Äthiopien und Deutschland, vom Fahrer über die Schotterpisten im äthiopischen Hochland bis zur Sekretärin an der Schreibmaschine in München. Vom leitenden Angestellten bis zur ehrenamtlichen Helferin – zahllose Menschen haben über 40 Jahre hinweg mit ihrem leidenschaftlichen Engagement den Namen Menschen für Menschen mit Leben gefüllt.
Sie alle haben viel zu erzählen – und einige von ihnen tun dies anlässlich des runden Geburtstags der Stiftung in diesem Blog. Durch die Augen derer, die hautnah dabei waren und sind, blicken wir hinter die Kulissen der Äthiopienhilfe. Zurück auf bemerkenswerte, lustige oder rührende Begebenheiten aus vier Jahrzehnten Entwicklungszusammenarbeit. Ein buntes Potpourri an Anekdoten, Erinnerungen und Begebenheiten – erzählt von Menschen für Menschen.
(40) Durchhaltevermögen und Zufälle: Nach der Wette begann die beschwerliche Arbeit erst richtig
(39) Äthiopische Essensrituale und Karlheinz Böhms Spargellust
(38) Abdi Ali – der Traumwächter von Menschen für Menschen
(37) Vom Auftakt zum Taktgeber: Menschen singen für Menschen
(36) Present at the Creation
(35) Warum ein äthiopischer Ochse einst wie ein deutscher Bundesminister hieß
(34) Verwirrung in Bonn: Wie Karlheinz Böhm den Minister aus der Fassung brachte
(33) Kamele als Währung und ein schlimmer Unfall: Karlheinz Böhms erster Mitarbeiter erzählt
(32) Geschichte der Nagaya-Briefe: Die Erfinderin erzählt
(31) Die Geschichte von Ali und dem Zauberkrug
(30) 30 Jahre Ehrenamt – diesen einen Moment mit Karlheinz Böhm werde ich nie vergessen
(29) Ruppige Landschaft, herzliche Menschen: Unser Besuch im Projektgebiet Merhabete
(28) „Dem Udo Jürgens haben wir beide heute Abend ordentlich eine verpasst“
(27) Die Story vom Pferd – oder: Wertschätzung hat viele Gesichter!
(26) Unterwegs zu den Menschen: Wie eine Äthiopien-Reise mit Karlheinz Böhm ablief
(25) Eine Entschuldigung zeigt, wie sehr Karlheinz Böhm die Menschen respektierte
(24) Die schönste Umarmung von einem wütenden Karlheinz Böhm
(23) 37 Jahre Spendenlauf in Ahrensburg – eine Erfolgsgeschichte
(22) Karlheinz und der Kaktus
(21) Zwischen Bergen von Post und selbst gebratenen Spiegeleiern – wie ich die Anfangszeit von MfM erlebte
(20) „Das war der Schlüssel zur Zusammenarbeit mit Karlheinz Böhm“
(19) Vom Erzählen und Zuhören: Wie die Idee der MfM-Mikrokredite geboren wurde
(18) Thomas Gottschalks Anruf veränderte alles: Die Geschichte von der Städtewette
(17) Sissi-Walzer in Addis Abeba: Als Karlheinz Böhm meinen Kindheitstraum erfüllte
(16) Wie ich Menschen für Menschen noch vor Karlheinz Böhms Wette unterstützte
(15) Eine Zwiebacktüte voller Geld: Die skurrilsten Spenden in 40 Jahren Menschen für Menschen
(14) Verwechslungsgefahr? Wie ich als deutscher Botschafter für Karlheinz Böhm gehalten wurde
(13) „Ich erwartete einen zornroten Karlheinz Böhm, doch dann…“
(12) Meet & Greet der besonderen Art: Als ich dem MfM-„Cover Girl“ leibhaftig begegnete
(11) „Überraschungen wie diese waren Karlheinz Böhms Spezialgebiet“
(10) „Machen statt reden: Wie mich eine Schulstunde mit Karlheinz Böhm prägte“
(9) „Manchmal staunen wir selbst: So funktioniert Hilfe zur Selbsthilfe in der Praxis“
(8) „My name is Karlheinz. Nice to meet you!“
(7) Frisches Roggenbrot und feuchte Augen: Meine luftige Freundschaft mit Karlheinz Böhm
(6) Als Karlheinz Böhm sich weigerte, auf Prominente zu schießen
(5) Ein Bauer macht Schule: Wie Hilfe gleich auf doppelt fruchtbaren Boden fiel
(4) Als sich ein bärtiger „Hochstapler“ als echter Zirkusdirektor entpuppte
(3) „Diese spontane Handlung von Karlheinz Böhm hat mich viel gelehrt“
(2) Büros für Menschen: Von schiefen Böden und legendären Grillfesten
(1) Die Anfänge: Wie Menschen für Menschen zu seinem Namen kam
Nach seiner berühmten Wette suchte Karlheinz Böhm medizinisches und technisches Personal, das mit ihm nach Afrika kommen würde. Doch das gestaltete sich reichlich schwierig, denn diese Fachkräfte mussten nicht nur willens, sondern auch frei von beruflicher Einbindung sein. Einfach drei Monate weg sein – das war für die meisten nicht möglich. Karlheinz versuchte alles Mögliche, doch von überall kamen nur Absagen.
Reichlich frustriert unternahm Karlheinz einen letzten Versuch und bat bekannte Schauspieler, die an Theatern gastierten, dort doch mal die „Theaterärzte“ anzusprechen. So wurde ein guter Freund von mir von einem der Schauspieler angefragt – und sagte spontan zu, Karlheinz Böhm von Dezember 1981 bis Februar 1982 nach Äthiopien zu begleiten.
Nun hatte Karlheinz einen Mediziner an seiner Seite, doch die Techniker-Frage blieb bestehen. Auf Anfrage, ob mein Freund vielleicht auch einen Techniker kennen würde, dachte dieser sofort an mich. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon 19 Jahre ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk tätig, darunter auch in mehreren Auslandseinsätzen.
Das Telefon klingelte: Karlheinz Böhm am Apparat
Als ich im September 1981 gerade aus dem Urlaub wiederkam, klingelte bei mir das Telefon – Karlheinz Böhm am Apparat. Doch so einfach konnte ich nicht zusagen. Hauptamtlich arbeitete ich zu diesem Zeitpunkt beim Fernmeldeamt der Deutschen Post. Zwar war der Arbeitgeber verpflichtet, mir als ehrenamtlichem Helfer des THW bei Einsätzen frei zu geben, dies funktionierte aber nicht für einen privaten Einsatz wie dieser es gewesen wäre.
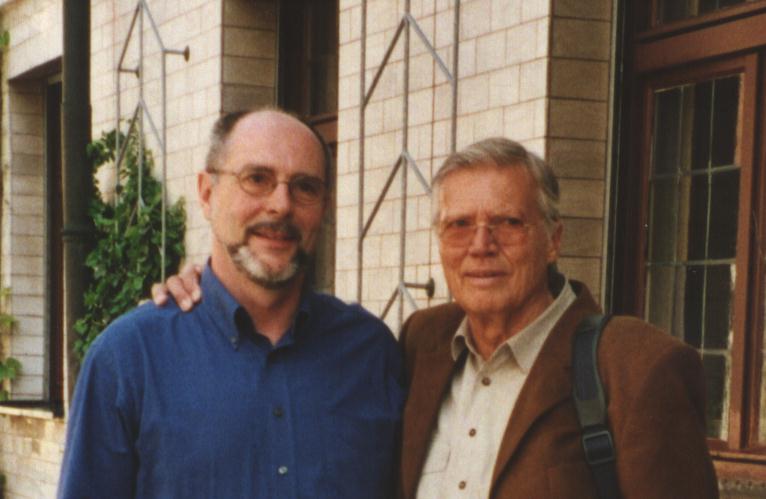
Sofort fragte ich bei meinem Niederlassungsleiter, meinen Kolleginnen und Kollegen nach, ob sie meine Aufgaben für den Zeitraum übernehmen könnten, diese waren einverstanden, auch die Direktion in Bremen hatte keine Einwände. Doch die Zentrale der Deutschen Post in Bonn blockierte das Vorhaben und wehrte sich, eine Befreiung für eine solche private Angelegenheit auszustellen.
Karlheinz wollte das nicht hinnehmen. Er fuhr kurzentschlossen nach Bonn, doch seine Überredungskünste zeigten keine Wirkung. An Aufgeben war nun, da Karlheinz einen potentiellen Begleiter in Aussicht hatte, jedoch nicht zu denken. Er bat um einen Termin mit dem Postminister Kurt Gscheidle und hatte nach einem einstündigen Gespräch, endlich die Genehmigung von oberster Stelle in der Hand. Es folgten einige behördliche administrative Schritte, doch dann war es soweit, wir konnten mit der Organisation unseres Aufenthalts beginnen.
Logistische Hürden und organisatorische Formalien
In seiner Wette hatte Karlheinz ja davon gesprochen, ein Land in der Sahelzone, welches von der Hungersnot stark betroffen war, zu unterstützen. Über die Welthungerhilfe bekamen wir den Hinweis auf den Tschad, den Sudan und auf Äthiopien. Der Tschad war durch anhaltende kriegerische Auseinandersetzungen keine Option, der Sudan lehnte unsere Anfrage ab, da das Land in der Zeit einigen Ärger mit ausländischen Hilfsorganisationen hatte. Der Botschafter Äthiopiens reagierte jedoch positiv auf unsere Anfrage, und nach einer weiteren Absprache stand fest: Wir werden nach Äthiopien gehen, um dort die Menschen zu unterstützen.
Nun begannen wir alle Dinge zu organisieren, die wir in Äthiopien selbst benötigten, darunter Zelte, Stühle, Tische, Feldbetten, Werkzeug und vieles mehr. Karlheinz wohnte damals am Rande von Düsseldorf, in Ratingen, und hatte von seinen Nachbar:innen eine Garage zur Unterbringung aller Dinge zur Verfügung gestellt bekommen. Diese war dann auch bis unters Dach mit Kartons und Kisten vollgestapelt. Was uns noch fehlte, waren Geländewagen. Ich wusste, dass Geländewagen von Toyota in Äthiopien am Gängigsten waren, dies würde es uns erleichtern, Ersatzteile zu bekommen.
Über den Kontakt des Autohändlers, von dem Karlheinz seinen Wagen bezogen hatte, konnten wir zwei Wagen für den Händlerpreis beziehen – mussten sie dazu aber in Rotterdam abholen. Der Hinweg nach Rotterdam war kein Problem, doch auf dem Rückweg wurden wir an der deutschen Grenze angehalten. Die Papiere der Fahrzeuge sollten uns erst in Deutschland ausgestellt werden, so hatten wir bisher nur ein Schreiben des Händlers und die Kennzeichen. Diese akzeptierte der deutsche Grenzbeamte aber nicht.
Karlheinz wurde laut, sah es nicht ein, dass ihm hier ein weiterer Stein in den Weg gelegt wurde. Weitere Zollbeamten kamen dazu, einer davon erkannte den berühmten Schauspieler Karlheinz Böhm, und nach einer längeren gemeinsamen Kaffeepause, in der Karlheinz allen von der Wette und seinem Projekt erzählte, durften wir ausnahmsweise weiterfahren.

In Deutschland baute ich die Geländewagen für den Einsatz in Äthiopien um. Größere Kühler waren nötig, die Dächer bekamen eine Reling und mussten für schwerere Ladungen verstärkt werden. Ein Wagen wurde mit einer Seilwinde ausgestattet. Auch hier halfen uns, wie so oft in diesen Monaten, nette Menschen, die von der Wette von Karlheinz gehört hatten. Die Söhne des Händlers, bei dem ich meine Toyota-Fahrzeuge immer bezogen hatte, halfen beim Ausbau, wir mussten nur die Materialkosten übernehmen. Eines der Autos hatte ich vor dem Umbau auch mit einem THW-Kameraden einmal komplett zerlegt und wiederaufgebaut, damit ich es, im Falle eines Unfalls, reparieren konnte und wusste, wie man an alles rankommt.
Inzwischen hatte Karlheinz alles Formale für die Reise wie Flugtickets oder Visa organisiert. Insgesamt waren wir nun vier Personen, Karlheinz und ich plus seine damalige Lebensgefährtin und sein Freund aus Österreich, die im Dezember 1981 nach Äthiopien fliegen wollten.
Dann ging es los - Flug nach Äthiopien
Nun wurden alle Garagen-Inhalte mit einem LKW nach Frankfurt gebracht, dazu unsere beiden Toyotas. Einen Wagen füllten wir mit allen Koffern von uns, damit wir diese direkt bei der Ankunft in Äthiopien hatten, und in den zweiten kamen alle empfindlichen Medikamente und ärztlichen Gerätschaften.
In Frankfurt schauten wir am Flughafen auch noch bei der Verladung auf die Cargo Maschine zu, es lief alles nach Plan. Wir flogen am folgenden Tag mit einer Passagiermaschine hinterher – nach allen Mühen und Hürden in Deutschland konnte die eigentliche Arbeit in Äthiopien endlich beginnen.
In Addis gelandet, kam Karlheinz uns ganz aufgeregt auf dem Flugfeld entgegen gelaufen und teilte uns mit, dass ein Geländewagen– natürlich genau der mit unseren Koffern – fehlte. Die Frachtmaschine hatte in Rom eine Zwischenlandung gemacht, dort war unser Toyota aus- und ein Flugzeugtriebwerk, was dringend in Addis benötigt wurde, eingeladen worden. Nun waren wir endlich vor Ort, hatten jedoch nichts als unser Handgepäck und mussten eine ganze Woche warten, bis die nächste Frachtmaschine mit unserem zweiten Wagen eintreffen würde. Schnell wurde von der Regierung für uns die erforderliche Kleidung von einer äthiopischen Hilfsorganisation organisiert.
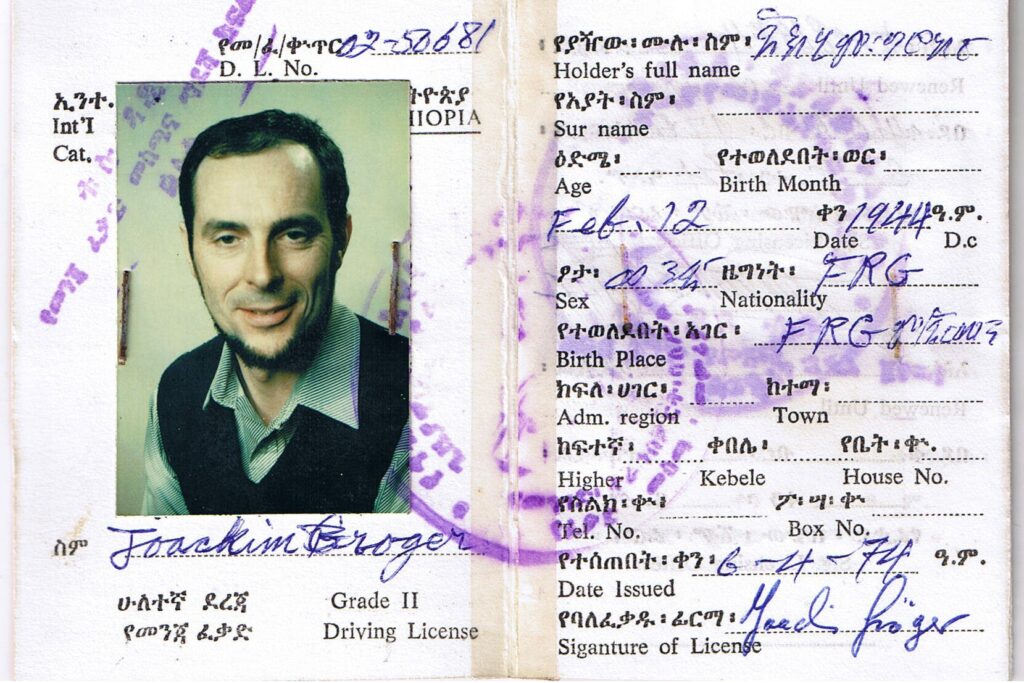
Als der sehnsüchtig erwartete Geländewagen endlich kam, stellten wir uns den nächsten Hürden: Erst hatte der Zoll alles blockiert, dies ließ sich nach vielen Verhandlungen jedoch klären. Dann war es in Äthiopien verpflichtend, dass wir nicht selbst die Wagen fahren, sondern einen Fahrer dazu anstellen sollten – obwohl wir einen internationalen Führerschein hatten! Dies akzeptierte Karlheinz nicht. Er verwies auf die Zusage, dass wir uns frei im Land bewegen dürften und dazu gehört auch, dass wir Selbstfahrer sind. Von der Regierung wurde uns ein Mitarbeiter von der Relief and Rehabilitation Commission (RRC), eine äthiopische Regierungsbehörde, zur Seite gestellt. Mit dessen Hilfe wurde uns nach vielen weiteren Behördengängen dann aber auch endlich der äthiopische Führerschein ausgestellt, und somit die Erlaubnis gegeben, uns im ganzen Land frei zu bewegen.
Von Babile ins Erer-Tal: Umsiedlung der Geflüchteten
Dann war es endlich soweit und wir trafen im Erer-Tal in der Lepra-Station in Bissidemo ein. Kurz darauf besichtigten wir das Flüchtlingslager in Babile. Dort trafen wir auf Berhanu Negussie, der im Lager als Sozialarbeiter tätig war. Er bot uns seine Unterstützung als Dolmetscher an und wurde schnell ein vertrauter Mitarbeiter und Wegbegleiter von Karlheinz Böhm.

Am 23. Dezember 1981 bekamen wir von den Behörden in Harar die Genehmigung zur Umsiedlung der Flüchtlinge aus dem Elendslager. Dazu wurde im Erer-Tal, das nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Farmgelände, für die Errichtung von vier Dörfern von der örtlichen Administration zur Verfügung gestellt. Das Erer-Tal war ideal für die Landwirtschaft, in der Regenzeit schlängelt sich der Erer-Fluss durch das Tal, auch in der Trockenzeit ist es ein sogenannter Trockenfluss. Schon nach wenigen Metern ist eine unterirdische Strömung erkennbar. Und wo Wasser ist, da ist auch Leben – und man könnte den Menschen, welche durch Dürren und Armut in die Lager gewandert waren, helfen, eine neue Lebensgrundlage aufzubauen.
Karlheinz gab den Hinweis, es mögen sich Sprecher der drei Volksgruppen im Lager finden, mit denen wir die Vorgehensweise für die Umsiedlung besprechen können. Wir suchten im Lager tags darauf die Sprecher und weitere Bauern der verschiedenen Volksgruppen auf, fuhren zusammen ins Erer-Tal und besprachen mit ihnen, wie ein Neubeginn der landwirtschaftlichen Nutzung aussehen könnte. Auf der Rückfahrt zum Lager waren alle Beteiligten total euphorisch, Anspannung und Vorfreude lag in der Luft.
Leider waren viele Menschen im Lager sehr krank. Der Arzt, der uns begleitete, versorgte ab Januar täglich fast 300 Personen. Ich assistierte, als Rettungssanitäter, wo ich konnte, während ich mich nachmittags gleichzeitig darum kümmerte, auf dem Farmgelände im Erer-Tal die landwirtschaftliche Technik, wie Traktoren, Drehbänke, Esse und viele weitere kleine Maschinen wieder in Gang zu bringen.
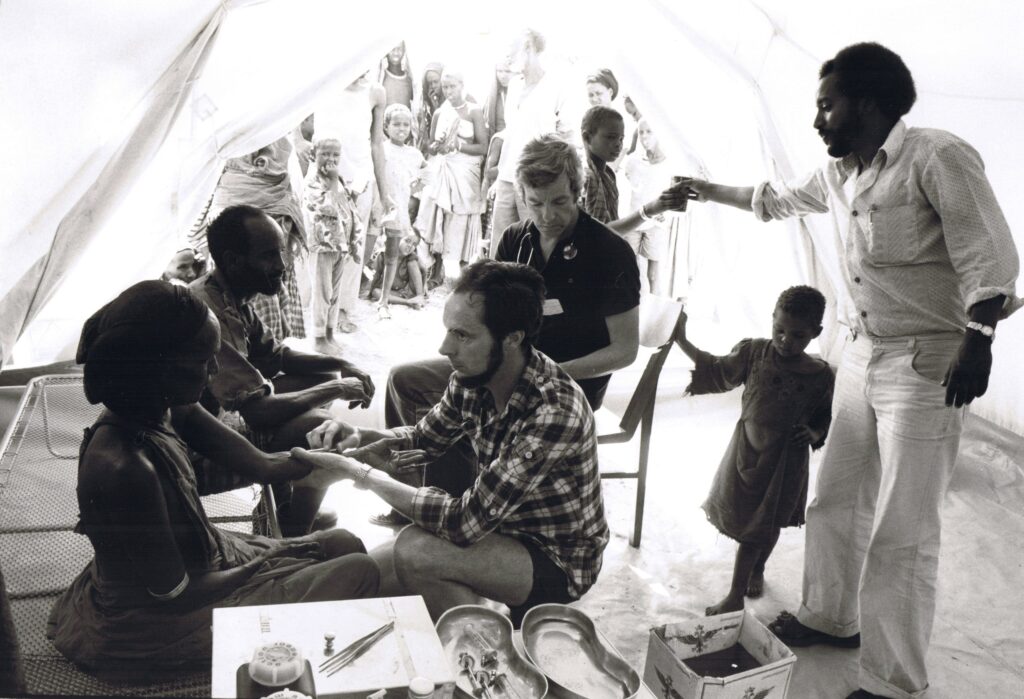
Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch mit der Umsiedlung der ersten zehn Familien, die sich bereit erklärt hatten und die gesund und kräftig genug für ein solches Unterfangen waren, begonnen. Die Familien bezogen die rechteckigen Strohhäuser, welche wir gemeinsam mittels Ästen, Stämmen und Schilf vom Flussufer, nach der Bauweise, wie es das THW in Katastrophengebieten lehrt, gebaut hatten. Alle neu umgesiedelten Familien bauten weitere Häuser für die folgenden Familien. Ein Schneeballsystem. So konnten nach und nach immer mehr Familien aus dem Lager geholt werden – bis Februar 1982 entstanden die Dörfer Nagaya und Abdi.
Doch das war nur ein Teil der Arbeit
Viele weitere Dinge passierten nebenbei, wir ruhten uns nicht aus. Ein medizinisches Lager wurde in den Dörfern errichtet, Zufahrtswege zu den Dörfern wurden mit einem Grader eingeebnet, damit große LKW problemlos Materialien anliefern konnten. Auch erste Brunnen wurden geschaffen, genauso wie eine Toilette an den Dorfrändern. Dank meiner Kenntnisse durch Lehrgänge und Einsätze vom THW machten die Ausführung dieser Arbeiten einfach.

Mitte Februar flog ich zurück nach Deutschland, erschöpft, aber voller Bewunderung für all das, was wir in so kurzer Zeit schon erreichen konnten. Aus Deutschland kümmerte ich mich weiterhin um die Beschaffung von Gerätschaften, Werkzeug und allen weiteren Dingen, die in Äthiopien zum Ausbau der Dörfer benötigt wurden und nicht vor Ort bezogen werden konnten.
Nachdem sich auch in Deutschland langsam ein festes MfM-Büro etablierte, konnte ich bald die Logistik abgeben und hielt viele Vorträge über die Arbeit von MfM vor Ort. Bis heute habe ich mehr als 3.000 Vorträge halten können, zusätzlich wurde ich regionaler Ansprechpartner in Norddeutschland von MfM und später stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats. Momentan bin ich im Kuratorium der Stiftung weiterhin tätig.

Rückblickend auf diese Anfänge ist es wahnsinnig beeindruckend, was MfM bis heute alles erreichen und gemeinsam mit den Menschen vor Ort umsetzen konnte. Ich bin sehr stolz und dankbar, von Anfang an dabei gewesen zu sein.
Joachim Gröger war von Anfang an mit dabei – eher dem Zufall geschuldet begleitete er 1981 Karlheinz Böhm nach Äthiopien und unterstützte bei der Umsiedlung der Bauernfamilien aus dem Flüchtlingslager Babile ins Erer-Tal. In den darauffolgenden Jahrzehnten war er Regionaler Ansprechpartner von MfM in Norddeutschland, enger Vertrauter von Karlheinz Böhm und längere Zeit stellvertretender Stifungsratsvorsitzender. Bis heute ist er als Kuratoriumsmitglied tätig.
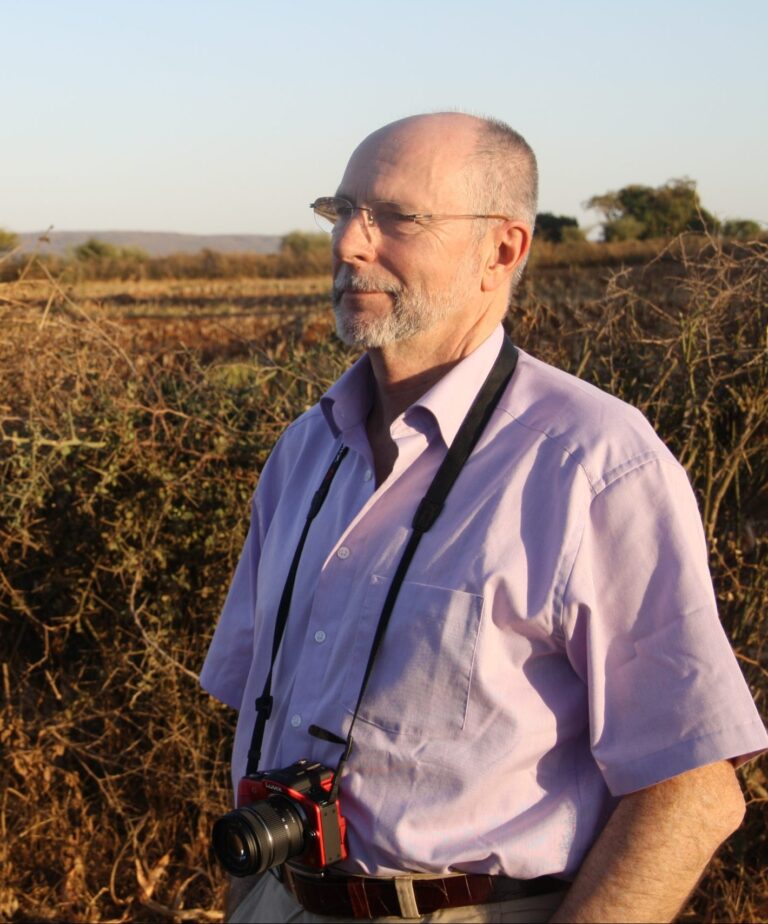
Karlheinz Böhm legte immer viel Wert darauf, Zeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam zu verbringen, wenn er in München war. So gingen wir Anfang der 90er, als ich noch recht neu bei MfM war, einmal mit dem gesamten Team äthiopisch Essen. Wir saßen alle um einen runden Tisch, Almaz Böhm saß direkt neben mir.
Wer äthiopisches Essen kennt, weiß, dass es mit den Fingern gegessen wird. Also fingen wir alle an, das Fladenbrot Injera in Stücke zu reißen und in die verschiedenen köstlichen Soßen zu tunken. Auf einmal steckte mir Almaz Böhm eine Portion mit ihren Fingern in den Mund! Ich war total perplex – schließlich kannte ich sie kaum!

Die anderen am Tisch müssen meinen äußerst verwirrten und peinlich berührten Blick bemerkt haben und brachen in großes Gelächter aus. Ich wurde ganz rot und schaute fragend in die Runde, bis Karlheinz Böhm mir erklärte, dass es in Äthiopiens Kultur ein Zeichen von Freundschaft und Zuneigung ist, wenn an der Tafel auf diese traditionelle Weise Essen gereicht wird.
Eindeutig ein Team-Building der ganz besonderen Art!

Äthiopisches Büffet und Spargelwochen
Ums Essen geht es auch bei einer anderen Erinnerung an Karlheinz Böhm: Viele Jahre nach meiner Anstellung bei MfM war ich als Hoteldirektor im Hilton in Dortmund tätig. Durch die Stiftung dem Land immer noch sehr verbunden, führten wir im Hotelrestaurant äthiopische Wochen durch.
Als Höhepunkt sollte es eine große Veranstaltung mit Karlheinz Böhm zu Gast geben, verbunden mit einer klassischen Spendenaktion. Schon Wochen vorher hatten wir die Werbetrommeln gerührt, Leute aus der Wirtschaft, Politik, Journalisten und auch Schülerinnen und Schüler aus Dortmund eingeladen. Gemeinsam mit einem Redakteur vom WDR war eine Art Talkshow geplant, bei der Karlheinz Böhm auf großer Bühne interviewt wurde.
Auch für den gastronomischen Teil der Äthiopienwochen, nicht nur für den einen Abend der Veranstaltung, hatten wir unser absolut Bestes gegeben. Schon Wochen vorher hatten wir uns von den Köch:innen aus dem Hilton Hotel in Addis Abeba Rezepte zukommen lassen, dann Rohstoffe aus Äthiopien besorgt und ein äthiopisches Buffet zubereitet – natürlich auch in der Hoffnung, dass sich Karlheinz Böhm darüber ganz besonders freuen würde.
Als alle Gäste nach der Talkshow zum Buffet im Ballsaal liefen, bekam Karlheinz Böhm jedoch mit, dass im Hotelrestaurant parallel auch Spargelwoche war. Er war nicht zu bremsen und lief schnurstracks Richtung Restaurant. Es war herrlich zu sehen, mit welchem Genuss er den Spargel zu sich nahm, etwas, was er durch seine viele Zeit in Äthiopien wohl viel seltener aß. Die Gäste genossen gleichzeitig das äthiopische Büffet als Novum in Dortmund.
Nachdem Stephan Stahl eine Talkshow mit Karlheinz Böhm und Rupert Neudeck im Fernsehen sah, wollte er sich aktiv für den guten Zweck engagieren und rief spontan bei Menschen für Menschen an. So stieg er erst ehrenamtlich, und Anfang der 1990er für zwei Jahre auch hauptberuflich bei Menschen für Menschen ein. Später wandte er sich beruflich wieder der Hotellerie zu, hielt jedoch weiterhin Kontakt zur Stiftung und organisierte auch einige gemeinsame Veranstaltungen.

Im Januar 1984 fuhr ich das erste Mal, auf eigene Rechnung, nach Äthiopien – einfach, weil ich mehr über die Arbeit von Menschen für Menschen vor Ort in Äthiopien wissen wollte, nachdem ich ja nun schon zwei Jahre im Münchner Büro gearbeitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur ein Projektgebiet, das Erer-Tal, in das mehrere Tausend Halbnomad:innen, welche durch Dürren jegliche Lebensgrundlage verloren hatten, aus dem Hungerlager Babile umgesiedelt waren.
Bei diesem Aufenthalt in Erer waren gleichzeitig mit mir eine junge Österreicherin namens Claudia (eine gelernte Entwicklungshelferin) vor Ort, die vielleicht dort einen Job übernehmen sollte; ein Zahnarzt aus Düsseldorf, der sich darüber unterrichten wollte, welche Möglichkeiten es gäbe, die Zahnmedizin in kleinem Maße in MfMs Krankenstation anzusiedeln, mit seiner Partnerin, und natürlich Karlheinz Böhm plus seine damalige Freundin sowie Tibor, der landwirtschaftliche Leiter des Projektes.
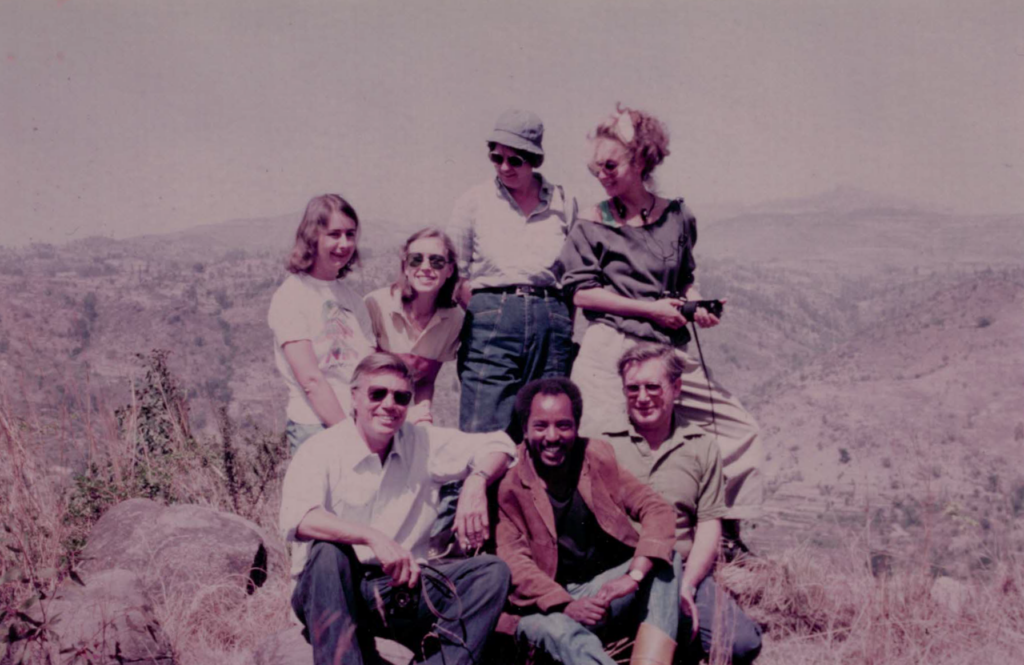
Wir waren eine ziemlich vergnügte Runde, die nach getaner Arbeit abends oft beim Essen zusammensaß und den Tag ausklingen ließ. Eines Abends stießen auch noch zwei kubanische Offiziere aus einem Ausbildungscamp nicht weit von Erer zu uns, in dem die äthiopischen Soldaten damals von den Kubanern lernten. Den Offizieren war es dort langweilig und ab und zu tauchten sie in Erer auf, um was Vernünftiges zu trinken zu bekommen und Gesellschaft zu haben.
Abdi Ali - ein Mann der ersten Stunde
Im Laufe des Abends kam auch noch Abdi Ali, der „Bürgermeister“ eines der Siedlerdörfer und setzte sich zu uns. Abdi Ali, heute 86 Jahre alt, war einer der ersten Siedler aus dem Halbnomadenstamm der Hauiwa und sozusagen ein Mann der ersten Stunde. In seiner Kindheit war er gemeinsam mit seiner Familie noch als Nomade durch das Grenzgebiet zwischen Somalia und Äthiopien gezogen, wurde dann jedoch durch Krieg und Dürre vertrieben und kam so ins Hungerlager Babile. Mit ihm und einigen anderen begann Karlheinz Böhm seine Arbeit in Äthiopien und gründete die ersten Dörfer im Erer-Tal.

Abdi Ali verstand natürlich kein Wort von unserer Unterhaltung und trank als Moslem auch keinen Wein. Aber das Glas Milch, das ihm statt Wein eingeschenkt wurde, trank er mit Bedacht und verschwand wieder. Karlheinz und die anderen verschwanden auch, und Claudia und ich saßen da mit den beiden Kubanern. Die waren zwar sehr nett, aber wir waren müde, wollten jedoch nicht so unhöflich sein wie die anderen. Irgendwann verabschiedeten sich die Kubaner schließlich, und als wir aus dem Küchen- und Speisehaus kamen, saß da Abdi Ali mit dem Gewehr über den Knien neben der Tür. Wir wunderten uns sehr – denn wir dachten, er wäre wie alle anderen schlafen gegangen.

Auf unsere Nachfrage erzählte er unserem Dolmetscher am nächsten Tag, er hätte auf uns aufgepasst, bei Soldaten könne man nie wissen. Später erfuhr ich auch, dass Abdi Ali diesen Wachdienst auch schon bei Karlheinz Böhm etabliert hatte. Immer, wenn Karlheinz Böhm in Erer war, setzte er sich nachts vor dessen Haustür und wachte über seinen Schlaf – aus Dankbarkeit für alles, was ihm durch die Arbeit von Menschen für Menschen ermöglicht wurde.
Barbara Ertl war ab 1982 die erste, damals ehrenamtliche, Sekretärin der heutigen Stiftung Menschen für Menschen. Ab 1983 leitete sie dann das erste wirkliche MfM-Büro in der Kaufinger Straße. Nach ihrem Umzug nach Berlin 1986 war sie weiterhin ehrenamtlich im Arbeitskreis tätig.

Als Musiklehrer und Chorleiter standen bei mir 1988 zwei Jubiläen an: 25 Jahre Chorleiter und 15 Jahre Kreischorleiter. Das sollte gebührend gefeiert werden, allerdings wollte ich dabei den guten Zweck in den Vordergrund stellen. Ich stieß bei meiner Suche nach einer geeigneten gemeinnützigen Organisation eher zufällig auf Menschen für Menschen, deren Arbeitsansatz mir gefiel. So entschied ich mich, in meiner Heimatstadt Selm ein großes Benefizkonzert zugunsten der Stiftung zur Feier der Jubiläen auf die Beine zu stellen.
Gemeinsam mit einer dafür gegründeten Arbeitsgruppe organisierten wir in den nächsten Wochen alles im Detail, ein ganzes Konzertprogramm mit den verschiedensten Chören wurde erstellt, als Veranstaltungsort wurde die große Schul-Turnhalle reserviert und wir verbrachten viel Zeit mit dem Verkauf der Tickets, der Akquise von Sponsoren etc. Natürlich wurde auch der Gründer der Stiftung, Karlheinz Böhm, eingeladen, und wir freuten uns riesig, als dieser auch zusagte.
Der Auftakt: Benefizkonzert in Selm
Am 9. September 1988 war es dann soweit: Karlheinz Böhm stand schon am Morgen des Tages bei uns auf der Fußmatte – und als er das Klavier in meinem Wohnzimmer sah, setzte er sich erstmal spontan daran und spielte ein paar Stücke. Der Mann war mir auf Anhieb sympathisch. Nachdem Karlheinz Böhm am Nachmittag noch in der Schule den Kindern und Jugendlichen von Äthiopien und seiner Arbeit vor Ort berichtete, stand dann abends das Konzert an.
Alles lief wie am Schnürchen, die Musik riss alle mit und es hätte schöner nicht sein können. Auch eine ganz besondere Überraschung hatten wir im Programm: Der Kinderchor mit 80 Mädchen und Jungen sang unter meiner Leitung das „Lied an Karlheinz Böhm“, welches ich, basierend auf der Melodie von einem Lied Rosenstengels, geschrieben hatte. Ich war doch mächtig aufgeregt, ob auch alles klappen würde – doch die Sorge war völlig unberechtigt. Sehen und hören Sie selbst:
Karlheinz Böhm stürmte nach dem Lied auf die Bühne, umarmte mich überschwänglich und es war klar: Die Überraschung war gelungen. Am Ende konnten wir einen Spendenscheck von 60.000 DM überreichen – eine Summe, mit der niemand von uns gerechnet hätte.
Langjähriges und taktgebendes Engagement
Aus diesem zunächst einmaligen Engagement wurde in der Folge so viel mehr, wir gründeten einen Arbeitskreis in Selm, ein paar Jahre später wurde ich dann auch regionaler Ansprechpartner von MfM für Nordrhein-Westfalen. Karlheinz Böhm traf ich so in den nächsten Jahren regelmäßig, organisierte viele Veranstaltungen und begleitete ihn auf Vorträge. Wir hatten immer eine tolle Zeit zusammen, er war so viel normaler als man das von einem bekannten Schauspieler erwartete.
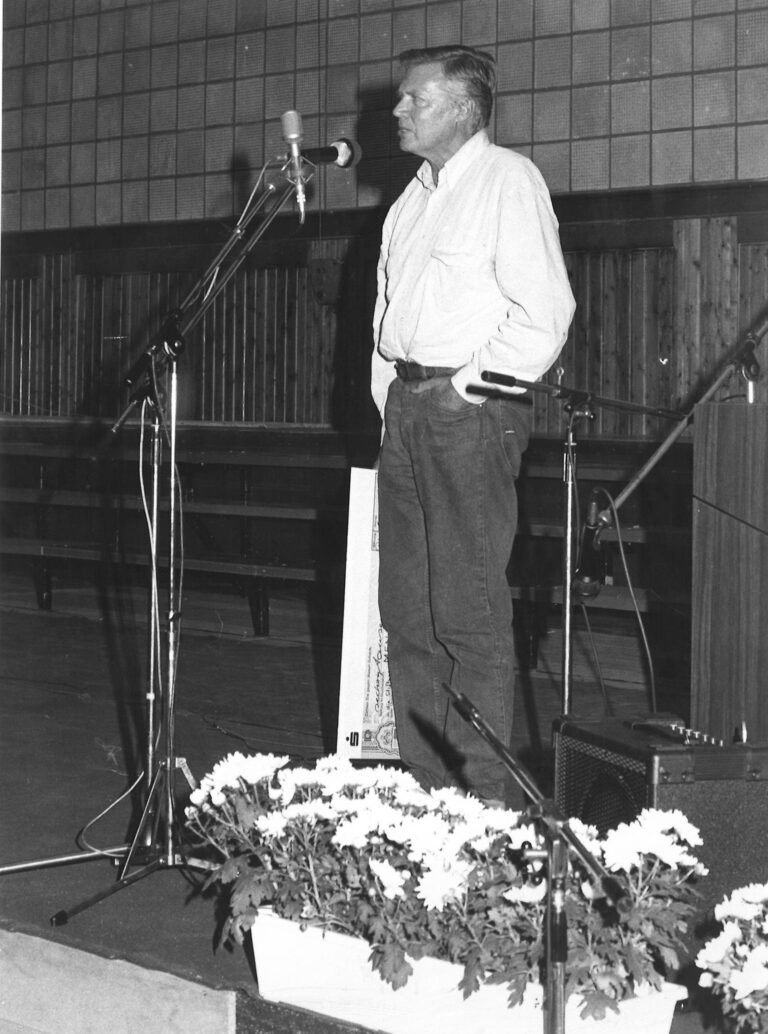
Zu den Highlights der vielen Erlebnisse in den folgenden Jahren gehörte definitiv auch das Benefiz-Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und der russischen Mannschaft Tsernomoretz Novorossisk in Selm 1995, bei dem auch Trainer Otmar Hitzfeld und Matthias Sammer dabei waren und über 100.000 DM Spenden zusammenkamen.
Ein weiteres persönliches Highlight war, als ich einmal bei Karlheinz Böhm zuhause in Salzburg zum Abendessen war und er mir eines der schönsten Geschenke meines Lebens machte. Wir saßen gemütlich beieinander, als Karlheinz plötzlich aufstand, zum Schrank ging, und ein kleines Kästchen daraus hervorholte, das er mir überreichte. Vorne war eine persönliche Widmung an mich darauf – und in dem Kästchen befand sich der Taktstock von Karls Vater, welcher einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit war. Ich war so gerührt, dass es mir die Sprache verschlug. Viele Konzerte habe ich seitdem mit diesem Taktstock dirigiert, es war jedes Mal etwas ganz Besonderes.
Das Benefizkonzert 1988 bildete so den Auftakt von 30 Jahren Engagement für Menschen für Menschen – es war eine sehr prägende Zeit, die mir bis heute immer wieder vor Augen führt: Wir brauchen Menschen für Menschen!
1988 rief Hans Wilhelm Schumacher aus Anlass zweier Jubiläen (15 Jahre Kreischorleiter und 25 Jahre Chorleiter) eine Arbeitsgruppe in seinem Heimatort Selm zusammen. Diese sollte ihn bei der Organisation eines Benefizkonzertes zugunsten MfMs unterstützen. Doch es blieb nicht bei diesem einem Konzert – daraus wurden 30 Jahre Engagement im Arbeitskreis Selm und auch als regionaler Ansprechpartner für Nordrhein-Westfalen. Noch dazu entstand eine enge Freundschaft mit Karlheinz Böhm.
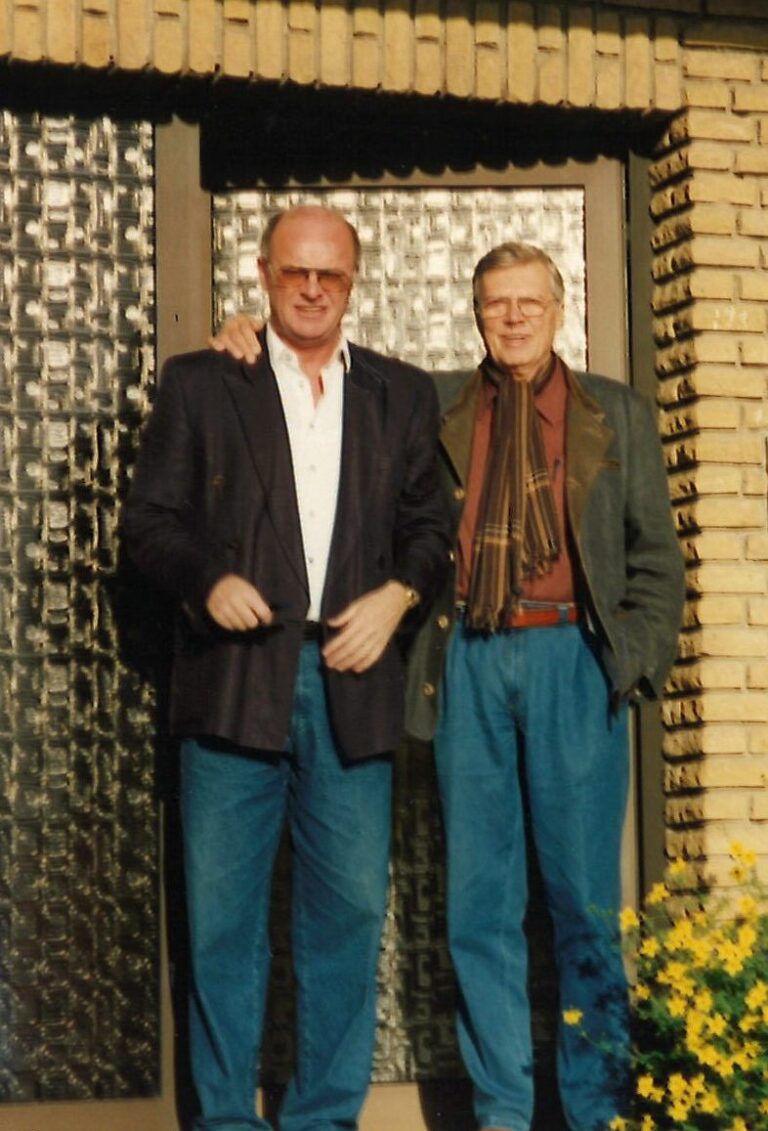
Überaus bewegend: Auf der kürzlichen Jubiläumsgala anlässlich des 40. Geburtstags von Menschen für Menschen in München hatte ich ein völlig überraschendes Wiedersehen nach 40 Jahren mit Ato Berhanu Negussie, dem erstem äthiopischen Mitarbeiter von Karlheinz Böhm.
Wie kam es dazu? Eine Rückblende: Oktober 1981, auf dem Frankfurter Flughafen kurz vor Abflug, die Lufthansa ließ ausrufen: „Herr Wrede, bitte zur Information!“ Dort bekam ich eine telefonische Weisung des Auswärtigen Amts: „Karlheinz Böhm ist in der Maschine nach Addis Abeba. Kümmern Sie sich um ihn!“ Seit Mai 1979 war ich unter anderem Kulturattaché der Botschaft in Addis Abeba. So lernte ich Karlheinz kennen: „Im Flug“.

In Addis Abeba holte uns Botschafter Rüdiger Freiherr von Pachelbel persönlich ab, er lud in die Residenz ein. Schon auf der Fahrt dahin schaffte es Karlheinz, sich zur Übernachtung daselbst einzuladen. Pachelbel ließ sich gerne „übertölpeln“, rief mich aber nach einigen Tagen an: „Wrede, übernehmen Sie!“ So zog Karlheinz für die nächsten Tage bei mir ein.
Gemeinsam haben wir die außerordentlich kooperativen Ministerien der äthiopischen Regierung aufgesucht. Sie ebneten Karlheinz die Wege ins Land, etwa zu dem Flüchtlingslager im ostäthiopischen Babile. Schnell ließ sich im fruchtbarem Erer-Tal ein Grundstück finden, wo Karlheinz viele Jahre regelmäßig lebte und besuchbar war (Ich durfte auch kommen).
Geholfen hat vom ersten Tag an Ato Berhanu, der als engster Mitarbeiter von Karlheinz später viele Jahre Landesrepräsentant der Stiftung war und zum Freund wurde. So unsere erste Begegnung – gleichsam „Present at the Creation“. Ich war Zeuge: Mitentscheidend für die heutige grandiose Erfolgsbilanz der Stiftung war die glaubwürdig spürbare Grundeinstellung von Karlheinz Böhm: Partnerschaft auf Augenhöhe, inspiriert von seinem Charme und seiner persönlichen Zugewandtheit.
Im März 1982 verließ ich Äthiopien, hatte danach unterschiedliche Auslandsposten. Mit Karlheinz blieb freundschaftlicher Kontakt. Auf meinem letzten Posten bei der Welternährungsorganisation in Rom Ende Juni 2011 hielt ich dann meine letzte Rede als deutscher Botschafter: unter äthiopischem (!) Vorsitz – der Kreis schließt sich.
Hans-Heinrich Wrede trat nach seiner Ausbildung als Volljurist 1977 in den Auswärtigen Dienst ein. Von Mai 1979 bis März 1982 war er als Kultur-, Presse-, Rechts – und Konsularreferent an der Deutschen Botschaft in Addis Abeba tätig. Hauptprojekt seiner Arbeit dort war die Nationale Alphabetisierungskampagne, für die Deutschland Äthiopien mit Studien-Stipendien, Ausstellungen von Künstler:innen und Forschungsaufenthalte von Wissenschaftler:innen unterstützte. Weitere Posten hielt er u.a. in La Paz, Wien und London, sowie als Botschafter bei der UNESCO und bis zu seiner unfreiwilligen Pensionierung bis 2011 in Rom als Botschafter bei der FAO, WFP und IFAD.
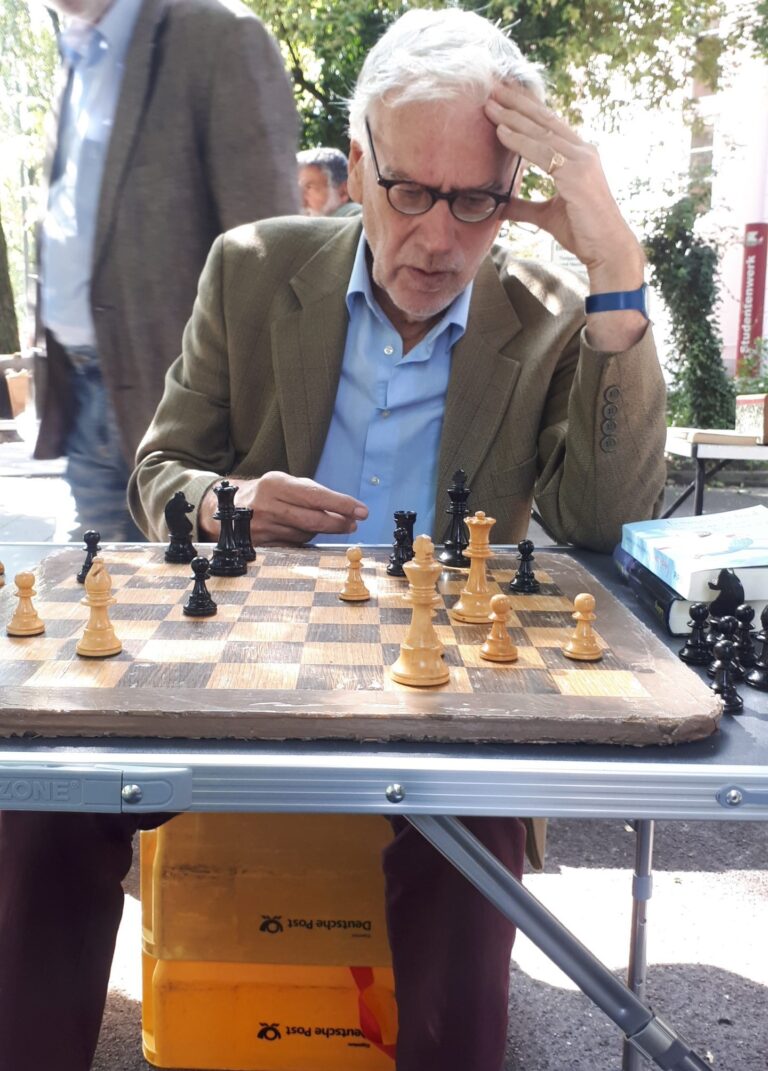

„1997 kam es zu der geplanten Reise von Carl-Dieter Spranger, dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, nach Äthiopien. Gemeinsam mit Karlheinz Böhm reiste er ins Hochland in unser damaliges Projektgebiet Merhabete.
Dort traf Minister Spranger auf genau den Bauern, von dem Karlheinz Böhm in dem vorangegangenen Treffen in Bonn ein Foto gezeigt hatte. Dieser Bauer, Ato Seleki, wurde als Modellfarmer von der Stiftung Menschen für Menschen unterstützt.
Was bedeutet das konkret? In den abgelegenen dörflichen Gemeinschaften fördert MfM mutige Bauern, die Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und bereit sind, ihre traditionelle Landwirtschaft nachhaltig und zukunftsträchtiger zu gestalten.
Konventionelle Getreidefelder werden zu multifunktionalen Gärten
Sie bekommen Samen und Setzlinge aus den stiftungseigenen Baumschulen zu einem vergünstigten Preis, und sie lernen von Fachleuten, wie sie durch einen ökologisch ausgerichteten Landbau mehr aus ihrem Boden herausholen – etwa über die Methode des “Agroforestry”.
Dabei werden konventionelle Getreidefelder in multifunktionale Gärten umgewandelt, in denen Ernten in mehreren Stockwerken möglich sind: Gemüse am Boden, Kaffee in Strauchhöhe, Obst an Bäumen. Die Zweige der Sesbania-Laubgehölze dienen als Viehfutter, außerdem gewinnen die Bauern wertvolles Bauholz, wenn der Schattenwurf der schnell wachsenden Silbereichen zu dicht wird und einzelne Bäume herausgeschlagen werden können.


Gewöhnlich ist zu Beginn lediglich einer von zehn Bauern innovationsfreudig. Die große Mehrheit wartet erst einmal ab. Aber sobald die ersten Ernten und Erfolge der Modellfarmer sichtbar werden, werden diese zu Vorbildern und in kurzer Zeit werden ganze Dörfer zu Nachahmern.
Minister Spranger nimmt's mit Humor
Herr Spranger war ganz begeistert von allem, was Ato Seleki ihm zeigte und wie herzlichst er von ihm aufgenommen wurde. Er beschloss, ihm einen speziellen Wunsch zu erfüllen. Auf Nachfrage erklärte Ato Seleki, dass er einen Ochsen gut gebrauchen könnte. Der Minister versprach, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
Zwei Monate nach dieser gemeinsamen Reise war Karlheinz Böhm wieder in Äthiopien und besuchte auch wieder die Projektregion Merhabete. Der Modellfarmer Ato Seleki präsentierte ihm ganz stolz den neuen Ochsen, ein rotbraunes, ungebärdiges Tier, welchem er – dem Schenkenden zu Ehren – den Namen „Spranger“ gegeben hatte.
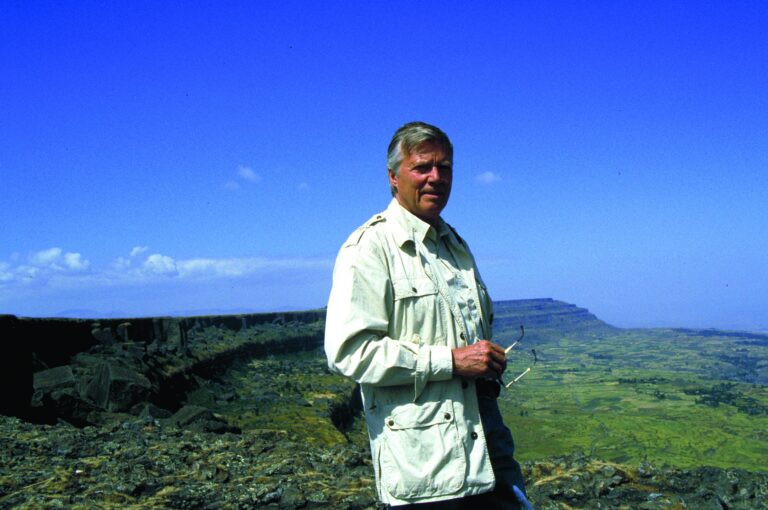
Als Karlheinz Böhm dies dem Minister am Telefon erzählte, lachte der laut auf – so einen Namensvetter im ländlichen Raum Äthiopiens hat schließlich kaum jemand.“
Rüdiger Hoffmann fing 1985 als Ehrenamtlicher bei Menschen für Menschen an und wurde dann ab 1986 festangestellt. Da das Team anfänglich noch sehr klein war, gehörte alles zu seinen Aufgaben: von Spendenquittungen, über Technik, zu Veranstaltungsorganisation bis hin zum Staubsaugen im Büro. Bis heute ist Rüdiger Hoffmann für den Einkauf, Transport und Logistik bei MfM zuständig.

In den ersten Jahren nach der Gründung von Menschen für Menschen stand Karlheinz Böhm staatlichen Fördermitteln für unsere Arbeit in Äthiopien stets skeptisch gegenüber. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit seinerzeit, Jürgen Warnke, verknüpfte die staatlichen Hilfen doch oft mit politischen Maßstäben, in dem nur Staaten mit einem ähnlichen Wirtschaftssystem wie dem der Bundesrepublik Deutschland Unterstützung bekommen sollten. Karlheinz Böhm hat dies stets angeprangert.
Doch in den 1990er-Jahren wuchs die Anzahl der Fördermöglichkeiten vom Bundesministerium stark, während die Spendenbereitschaft für MfM sank. So spielte ich mit dem Gedanken, dass man, um in der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin am Ball zu bleiben, auch staatliche Fördermittel in Erwägung ziehen sollte.

Lange redete ich darüber mit Karl. Am Ende beschlossen wir, uns zumindest mit dem damaligen Minister Carl-Dieter Spranger auszutauschen. Bald darauf wurden wir zu einem Gespräch ins Ministerium in Bonn eingeladen.
Steifer Rahmen und große Verwirrung
Das Treffen fand in einem riesigen Amtszimmer statt, mit Herrn Spranger am Kopf eines langen Tafeltischs, an der einen Seite sieben bis acht Referentinnen und Referenten seines Ministeriums, auf der anderen Seite Karlheinz Böhm und ich. Der Rahmen war steif und es wurde nicht besser dadurch, dass Herr Spranger das Treffen mit einem langen Monolog begann. So etwas lag Karlheinz Böhm gar nicht, er war immer für Dialog, für den Austausch und ein gleichwertiges Gespräch.
Nach etwa 15 Minuten, als Herr Spranger immer noch niemand anderen hatte zu Wort kommen lassen, fing Karlheinz neben mir an, in seiner Tasche unter dem Tisch zu kramen. Es war offensichtlich, dass er nach etwas suchte, genauso offensichtlich war, dass alle Anwesenden dies auch mitbekamen. Was macht er da bloß, dachte ich mir.
Dann schien Karlheinz Böhm gefunden zu haben, was auch immer er suchte, er zog zwei Fotos aus der Tasche und legte sie so vor sich auf den Tisch, dass die Fotos nach unten zeigten. Langsam, Zentimeter für Zentimeter, schob er die Fotos weiter in Richtung des Ministers. Dieser war total irritiert und unterbrach schließlich seine Rede.
Karlheinz Böhms unkonventielle Art und Weise
Diesen Moment nutze Karlheinz Böhm. Er sagte: „Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen“, und gab Herrn Spranger die Bilder. Auf einem war ein Bauer in Äthiopien, auf dem anderen Almaz und Nici, Karlheinz Böhms Familie, zu sehen. Herr Spranger war sichtlich durcheinander. Karl schaute ihn an und meinte: „Kommen Sie doch einfach mal nach Äthiopien und besuchen mich da.“ Punkt. Das war’s, nach einem kurzen weiteren Austausch verließen wir das Ministerium. An Fördermittel war – davon war ich überzeugt – nicht mehr zu denken. Doch, kaum zu glauben, nach zwei Wochen rief das Büro von Herrn Spranger an, dass dieser eine Reise nach Äthiopien plane und sich dort gerne mit Karlheinz Böhm treffen würde.
Was nimmt man daraus mit? Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass Herr Spranger nach unserem doch unkonventionellen Auftreten im Ministerium noch irgendein Interesse an uns und der Arbeit der Stiftung hätte. Und doch, er stimmte zu, und reiste kurze Zeit später nach Äthiopien, um mehr über die Arbeit von Menschen für Menschen vor Ort zu erfahren.

Karls Umgang mit den Menschen war anders, als es gerade in Politikkreisen üblich war. Und doch war es genau dieser direkte, bodenständige Umgang mit Menschen, immer auf Augenhöhe, durch die Karlheinz Böhm eine ganz andere Verbindung zu den Leuten aufbauen und sie für sich und sein Anliegen gewinnen konnte.
Wie es in Äthiopien mit Minister Carl-Dieter Spranger weiterging, erzählt MfM-Mitarbeiter Rüdiger Hoffmann in der nächsten Anekdote. Ein Protagonist dieser Geschichte: Der äthiopische Bauer auf dem Foto, das Karlheinz Böhm dem Minister gezeigt hatte…
Schon 1984 begann Axel Haasis als Schüler, ehrenamtlich für Menschen für Menschen zu arbeiten und setzte dieses Engagement auch während seines Studiums fort. Von 1993-2013 war er hauptamtlich für die Stiftung tätig, erst als Leiter der Fundraising-Abteilung (bis 2002), dann als Geschäftsführer.

Ich glaube, dass es mein Schicksal war, Menschen für Menschen zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Alles begann am 19. Dezember 1981. Ich arbeitete zu dem Zeitpunkt als Sozialarbeiter im Bisidimo-Krankenhaus, einem Leprakrankenhaus im Erer-Tal, das von der Deutschen Leprahilfe finanziert wurde.
An dem Tag war Karlheinz Böhm vor Ort und im Austausch mit dem Chef unseres Krankenhauses. Karl hatte zwar einen eigenen Übersetzer dabei, dieser konnte jedoch nur Amharisch-Englisch übersetzen, Karl jedoch suchte jemanden, der auch Afaan Oromo übersetzen konnte. Mein Chef nahm mich hinzu, und bat mich, Karlheinz Böhm für einen Tag als Übersetzer zu begleiten.
Während wir das Gelände auf unserer ersten Fahrt verließen, erzählte mir Karl, warum er nach Äthiopien, und insbesondere ins Erer-Tal, gekommen war. Ich war sehr beeindruckt von seinem Tatendrang und seiner Vision. An diesem Tag fuhren wir zum provisorischen Flüchtlingslager Babile. Ich bemühte mich nach Kräften, dem kulturellen Kontext entsprechend zu übersetzen, und ihm dabei noch mehr über die Beweggründe der Menschen zu erzählen. Ich glaube, das gefiel ihm, und nach unserer Rückkehr zum Krankenhaus bat er mich, dauerhaft für ihn als Übersetzer zu arbeiten.
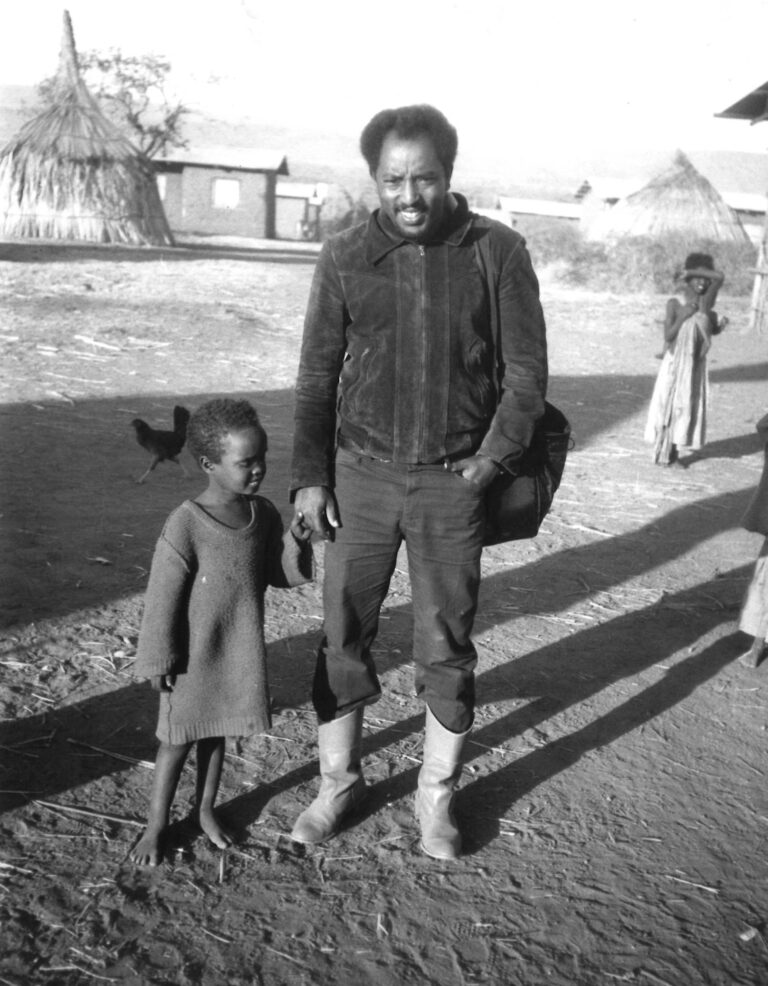
Der Beginn von so viel Neuem
So kam es, dass ich aus einer eintägigen Übersetzungstour über die nächsten Jahrzehnte meines Lebens entschied. Vieles habe ich gemeinsam mit Karl erlebt und ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an einige der Begebenheiten denke, die während meiner Tätigkeit als Übersetzer entstanden. Einige davon ergaben sich aus kulturellen Unterschieden. Andere wiederum sind auf den unterschiedlichen sozialen Status zurückzuführen. Das waren oft ganz schöne Herausforderungen.
Zum Beispiel hat Karlheinz Böhm oft versucht, die Menschen in den Projektgebieten mit Zahlen zu motivieren. Er pflegte zu sagen: „Wenn Sie hart arbeiten und Ihren Teil zu dem Projekt beitragen, gebe ich alles, um eine weitere Million Euro an Spendengeldern für Ihr Projekt zu sammeln.“ Aber sie wussten nie, was eine Million Euro bedeuten, wie viel Geld das war. Also musste ich den Betrag in Kamele umrechnen, um zu erklären, wie viele die Zahl bedeutet. Karl musste bei solchen Arten von Barrieren immer sehr schmunzeln.
Nach einigen Jahren Übersetzungsarbeit wurde ich zum Projektleiter in Merhabete befördert, von wo aus ich auch eine Zeitlang unsere Projektarbeit in Derra koordinierte.
Prägende Momente: unser schlimmer Unfall
Als langjähriger Mitarbeiter von Menschen für Menschen war meine tägliche Arbeit voll von Zwischenfällen, Höhen und Tiefen. An zwei davon – einen negativen und einen positiven – erinnere ich mich ganz besonders. Der erste davon war der Tag, an dem Karlheinz und ich einen Autounfall hatten. Das war im Jahr 2007. Wir waren auf dem Weg von Harar zum Flughafen Diredawa, um nach Addis zu fliegen. Als wir zwischen Haromaya und Awaday ankamen, stieß ein entgegenkommendes Fahrzeug in einer scharfen Kurve mit dem Fahrzeug der Stiftung zusammen.

Ich war eine Zeit lang bewusstlos. Als ich wieder wach wurde, war Karl nirgends zu sehen. Ich blutete stark, doch das war mir egal. Ich machte mich sofort auf die Suche nach Karl. Ich hatte große Angst, dass er nicht überlebt hatte. Zum Glück waren schon einige Bewohner aus dem naheliegenden Dorf an der Unfallstelle, einer von ihnen sagte mir, dass Karl am Leben und ins Krankenhaus gebracht worden sei. Nach einer Weile brachten sie mich auch ins Diredawa-Krankenhaus und schließlich sah ich Karlheinz auf dem Krankenbett liegen. Es ging ihm schlecht, und es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder auf den Beinen war.
Nach der Genesung sagte Karl oft zu mir: „Berhanu, ob du es glaubst oder nicht, der Unfall hat mich zehn Jahre älter gemacht“. Natürlich glaubte ich ihm das – ich war mir sogar sicher, dass es ihn noch schneller hat altern lassen, da er danach nie wieder körperlich so fit war wie zuvor. Trotzdem haben wir diese Zeit als Freunde gemeinsam gemeistert – es sind prägende Momente, die man nicht vergisst.
Eine ganz besondere Ehrung
Eine zweite Begebenheit erfüllt mich mit großem Stolz. Ich begann als Übersetzer für die Stiftung zu arbeiten. Nach vielen weiteren Schritten mit mehr und mehr Verantwortung wurde ich schließlich Landesrepräsentant von Menschen für Menschen in Äthiopien. In Anbetracht der 38 Jahre, die ich zu dem Zeitpunkt für Menschen für Menschen gearbeitet hatte, verlieh mir der deutsche Präsident 2019 das Bundesverdienstkreuz. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, es war etwas, womit ich niemals gerechnet hätte.

Heute bin ich im Ruhestand. Aber eine Lebensaufgabe gibt man nicht einfach mit der Pensionierung ab – und so berate ich weiterhin die aktuelle Führung des äthiopischen Teams. Denn meine Seele ist definitiv bei Menschen für Menschen geblieben.
Berhanu Negussie war der erste Mitarbeiter von Menschen für Menschen in Äthiopien – erst als Dolmetscher, dann als Projektmanager und schließlich von 2002 bis zu seiner Pensionierung 2020 als Landesrepräsentant. Noch dazu war er ein enger Vertrauter und ständiger Berater von Karlheinz Böhm, und unterstützt auch nach seiner Pensionierung MfM weiterhin in beratenden Tätigkeiten.

Anfang der 1980er hatte ich gerade mein Studium der Ethnologie und Afrikanistik in Wien beendet, als ich ganz zufällig Karlheinz Böhm kennenlernte. Ein Studienkollege nahm mich auf eine Lesung mit, auf der ich dem Gründer von Menschen für Menschen vorgestellt wurde.
Ich war nach dem Studium auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, war hoch motiviert, aber berufsunerfahren. Karlheinz hat schnell meine Talente erkannt und mich eingeladen, in dem bisher noch sehr kleinen österreichischen Verein Menschen für Menschen zu arbeiten.
Das Büro des österreichischen Vereins wächst
1986 wurde ich dort fest angestellt und mit viel Einsatz, Tatendrang und Improvisation haben wir rasch ein Büro bezogen (zuerst in der Büdingergasse und bald darauf das in der Capistrangasse, wo MfM Österreich bis heute seinen Sitz hat) und einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden, um die bereits bestehenden Gruppen von Freiwilligen und die wachsende Zahl an Spenderinnen und Spendern zu betreuen.
Wir organisierten Veranstaltungen für die Besuche von Karlheinz Böhm in Österreich, in der Zwischenzeit versorgte Karlheinz Böhm die Mitarbeitenden und Vereinsmitglieder gelegentlich mit persönlichen Briefen aus Äthiopien. Spenderinnen und Spender bekamen individuelle Dankbriefe mit Informationen über die Projektarbeit aus dem Büro. Doch der Bedarf nach regelmäßiger schriftlicher Information wuchs zunehmend, und daher überlegte ich mir, einen – wie man heute sagt – Newsletter zusammenzustellen, damals eine gedruckte Doppelseite mit den Neuigkeiten über die Projekte in Äthiopien und geplanten Veranstaltungen in Europa.
Von "Newsletter" zu Nagaya-Magazin
Daraus haben sich schnell die Nagaya-Briefe – die heutigen Nagaya Magazine – entwickelt, benannt nach dem ersten Dorf in Äthiopien, das von Menschen für Menschen gegründet worden war. In Wien fanden wir ein Druckhaus, das die Briefe gratis für uns druckte, und so versendeten wir von hier aus die Nagaya-Briefe für Österreich, und später dann auch nach Deutschland. Denn nachdem wir die Briefe anfangs nur innerhalb Österreichs versendeten, ordnete Karlheinz Böhm schnell an, dass der Brief auch für die anderen Länder übernommen werden sollte.
In jedem Nagaya-Brief gab es am Anfang immer noch den „Liebe Freunde“-Brief von Karlheinz Böhm persönlich, der erst nach seinem Rückzug zum Grußwort der jeweiligen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder Vorstände wurde. Außer einer weiteren Seite, bei der es um länderspezifische Aktionen ging, waren die Briefe für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis zu Karlheinz Böhms Tod identisch.
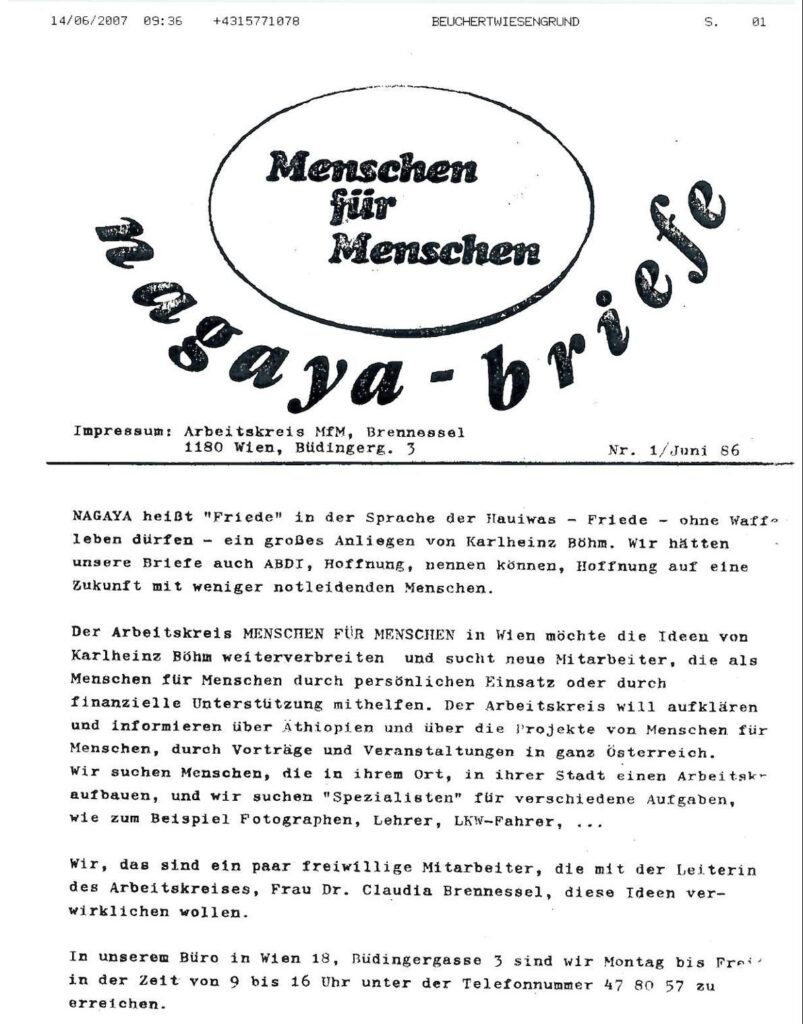
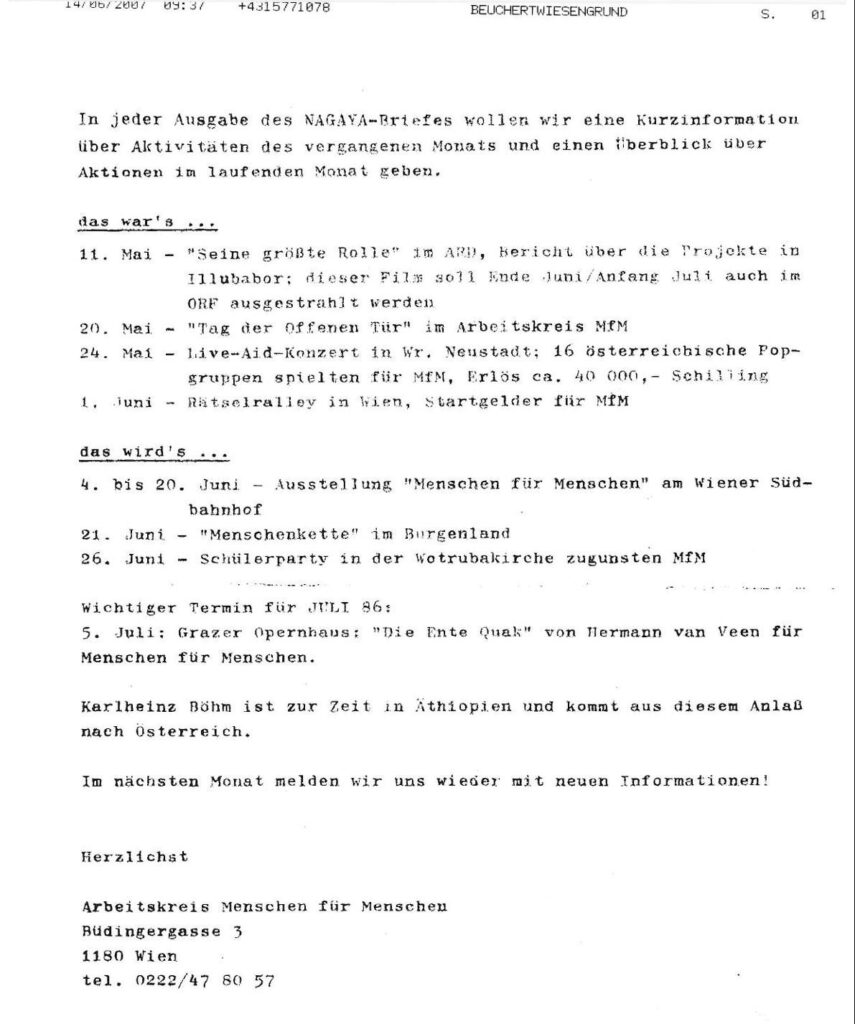
Die Gesamt-Redaktion alternierte im Lauf der Jahrzehnte zwischen den drei Ländern je nach Kapazität. Die Geschichten zugeliefert haben immer die PR-Referentinnen und -Referenten in Äthiopien, und abgestimmt werden musste alles mit den jeweiligen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und natürlich Karlheinz und Almaz Böhm. Die Produktion fand in dem Land statt, in dem sich gerade die günstigsten Druck- und Versandangebote einholen ließen. Separate Ausgaben wurden erst 2014 eingeführt, nachdem MfM Schweiz sich im Zuge der Umstrukturierungen verselbständigt und MfM Österreich auch ein komplett eigenes Redaktions- und Produktionsteam aufgestellt hatte.
Es freut mich sehr, dass sich die Idee der Nagaya-Briefe bis heute erhalten hat und auch, dass das Büro, das ich vor so vielen Jahren eingerichtet habe, weiterhin von Menschen für Menschen genutzt wird.
MfM hat mich geprägt
Die Zeit mit Karlheinz Böhm, meine erste feste Anstellung und Arbeit bei Menschen für Menschen haben meine weitere Berufslaufbahn stark geprägt. 1989 ging ich als Entwicklungshelferin nach Äthiopien, und verbrachte insgesamt über zehn Jahre dort und in Eritrea. Eine Zeit, in der ich die wunderbaren Menschen vor Ort und deren Kultur sehr lieb gewonnen habe. Ich arbeitete für einige internationale Hilfsorganisationen, doch die ersten Jahre bei MfM, meine erste feste Anstellung, sind bis heute etwas ganz Besonderes für mich.
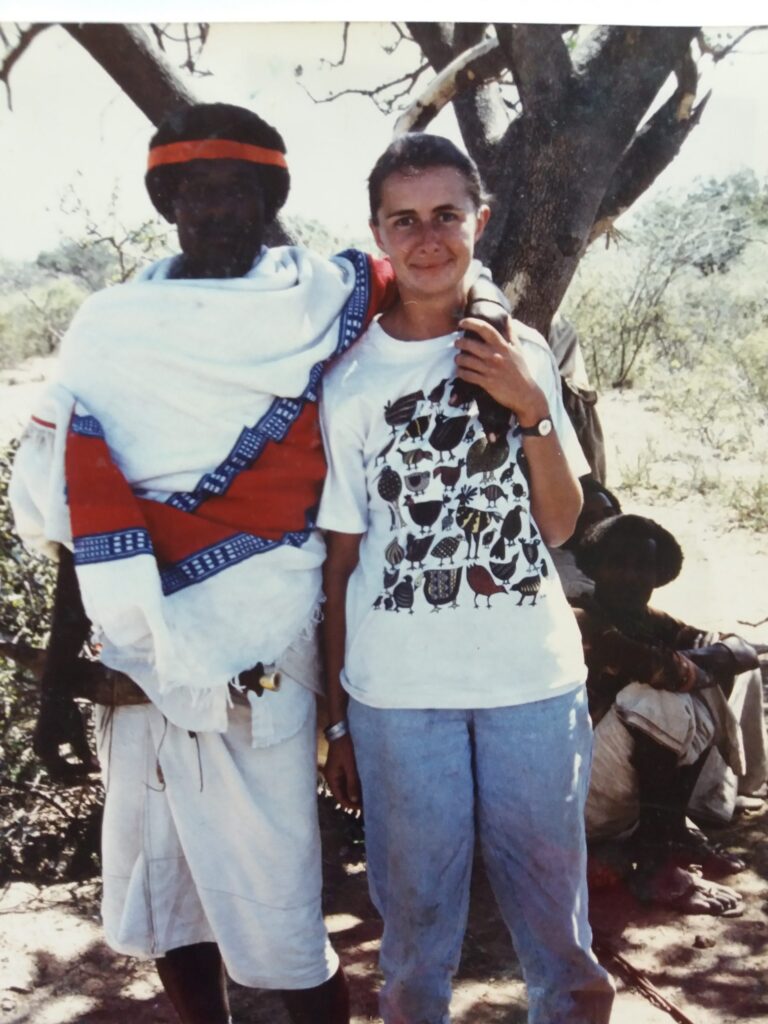
Mit Karlheinz Böhm zu arbeiten war einzigartig, seine Begeisterung, sein 1000-prozentiger Einsatz für die Sache waren mitreißend und motivierend. Die Arbeit für MfM in diesen ersten Entstehungsjahren war nie nur ein „Job“, wir lebten für die Aktion, für die Unterstützung der Menschen in Äthiopien.
Auch danach hat mich meine Arbeit immer wieder für kürzere Aufenthalte nach Äthiopien geführt. Etliche Male bin ich Karlheinz in Äthiopien begegnet. Auch bei meinem bisher letzten Aufenthalt vor drei Jahren habe ich natürlich wie immer den „Karlsplatz“ in Addis Abeba besucht, um die Büste, die dort zu Ehren von Karlheinz Böhm aufgestellt ist, zu umrunden.
Dr. Claudia Brennessel-Futterknecht lernte Karlheinz Böhm zufällig nach Abschluss ihres Studiums Mitte der 1980er in Wien kennen, und baute gemeinsam mit einem kleinen Team den österreichischen Verein Menschen für Menschen auf. In den darauffolgenden Jahre arbeitete sie als Entwicklungshelferin für verschiedene internationale Organisationen in vielen Ländern dieser Welt, darunter auch zehn Jahre in Äthiopien und Eritrea – ihre erste Festanstellung, die Arbeit mit Karlheinz Böhm und MfM behielt sie stets in guter Erinnerung.
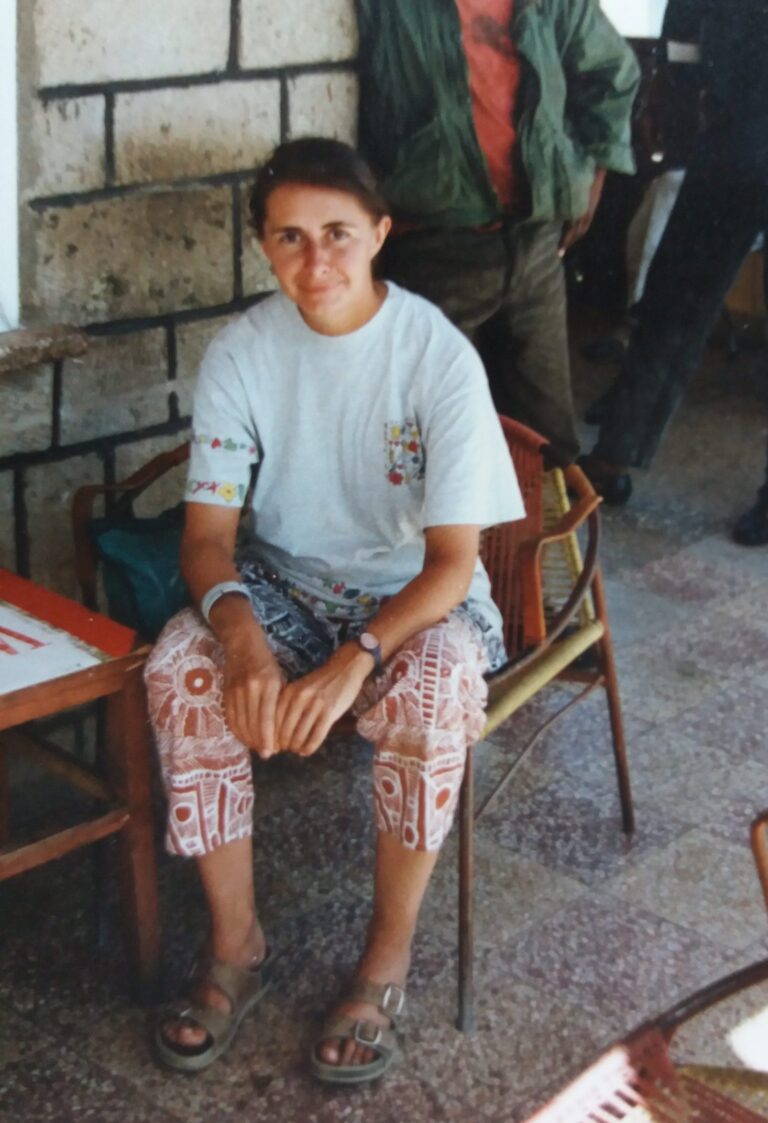
Runde Geburtstage eignen sich hervorragend dazu, wichtige Akzente für besondere Projekte zu setzen, indem man auf eigene Geschenke gerne verzichtet. Als ich am 14. Juli 2002 meinen 60. Geburtstag feierte, stand ganz klar eine Benefizveranstaltung zugunsten von Menschen für Menschen im Vordergrund. Es lag nahe, dass ich als Musikverleger einen musikalischen Akzent setze.
Zusammen mit einem der prominentesten Film-Komponisten Enjott Schneider suchte ich nach einem geeigneten afrikanischen Märchen. Afrikanische Märchen handeln sehr oft von gruseligen Begebenheiten. Doch ich fand schließlich die Geschichte von Ali und dem Zauberkrug, wobei ich das Ende der Geschichte entsprechend geschönt habe. Aminas Mutter verbrannte nicht, sondern sie verschwand für immer.
Als erstes Stück erklang aus der Feder von Enjott eine Musik über einen Film über Äthiopien. Danach kam dann das Märchen an die Reihe. Karlheinz Böhm übernahm die Rolle des Erzählers.
Das Märchen handelt von einem kleinen Jungen Ali, der zusammen mit seiner Mutter harte Feldarbeit verrichtet. Sein verstorbener Vater hat ihm seine Flöte vererbt, auf der er gerne und oft spielt. Als er sie eines Tages verloren glaubt und sie später wiederfindet, spielt er so schön wie nie zuvor auf ihr. Ein Geist, der von diesen Klängen geweckt wird, schenkt ihm als Belohnung für sein herrliches Spiel einen Zauberkrug. Den Zauberkrug soll Ali vor Sonnenuntergang zerschlagen. So getan bringen die Scherben ihm und seiner Mutter Glück und bescheidenen Wohlstand.
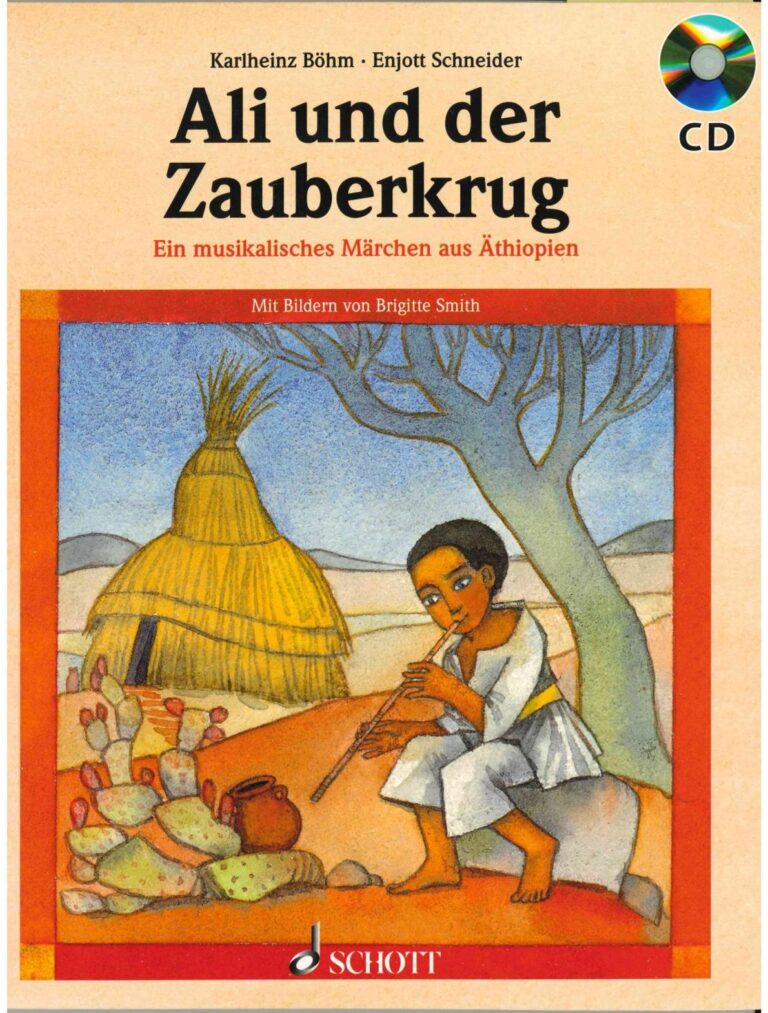
Über dieses so erfreuliche Geschehen freuen sich alle im Dorf. Bis auf die habgierige Mutter von Amina, Alis Cousine. Sie verlangt von Amina, sie solle sich sofort an die gleiche Stelle begeben, dort schön Flöte spielen und einen noch größeren Zauberkrug als Ali bekommen. Amina befolgt die Anweisung ihrer Mutter und versucht sich im Flötenspiel. Der von Amina geweckte Geist ist über das Flötenspiel eher erzürnt, aber er gibt Amina einen großen Krug mit der Auflage, diesen bei Sonnenuntergang zu zerschlagen. Sie selbst aber solle sich zu ihrem Freund Ali begeben.
Alina tut, was ihr vom Geist empfohlen wird, sie geht zu Ali und ihre Mutter zerschlägt den Krug. Es erhebt sich sogleich ein großes Unwetter und ein Blitz zerstört die Hütte von Aminas Mutter. Aminas Mutter ist ab dem nächsten Morgen nie mehr gesehen. Amina lebt von da an bei Ali und seiner Mutter und beide musizieren oft und gerne zusammen.
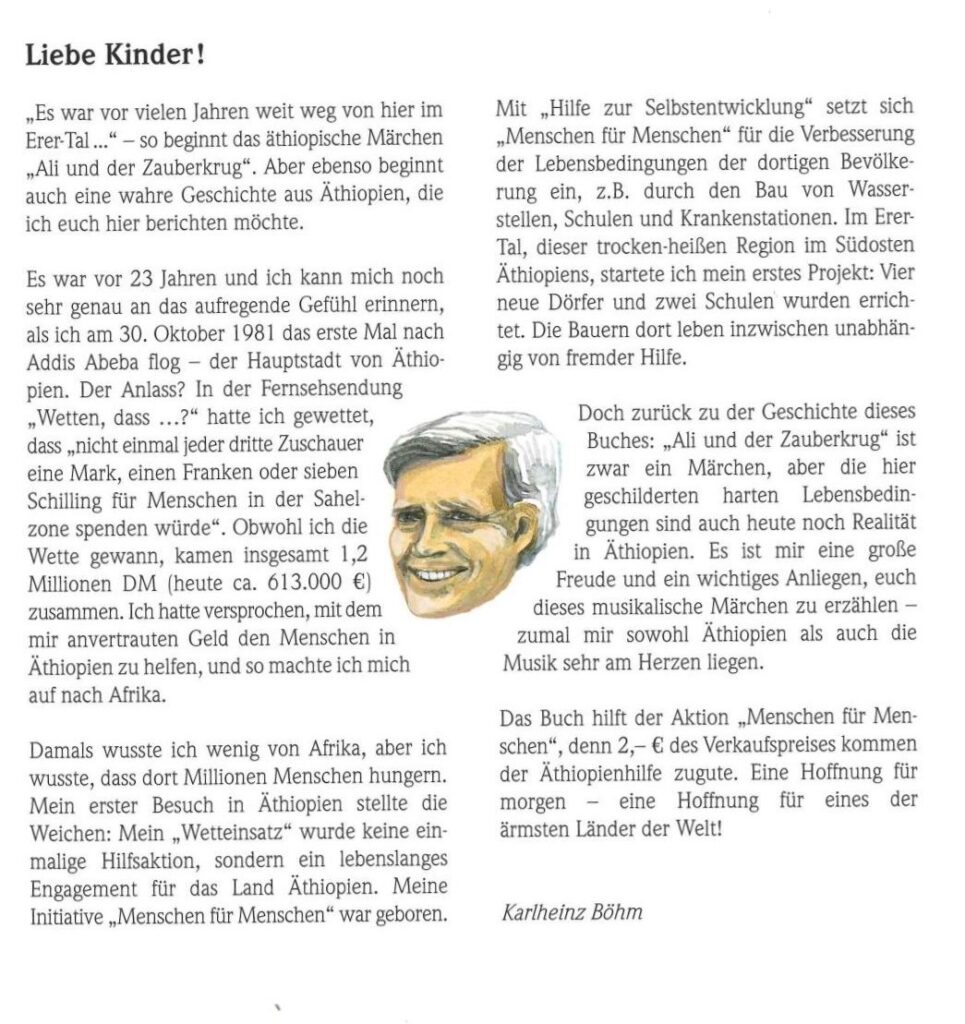
Das Stück wurde uraufgeführt im Rahmen dieser Benefizveranstaltung, die unter dem Motto „Music Connects The World“ stand. Karlheinz Böhm übernahm an diesem Vormittag die Rolle des Sprechers und hatte mit seiner so gekonnten Darstellung großen Erfolg im ausverkauften Haus. Besonders schön war es natürlich, dass die eingeladenen Gäste mit besonders großzügigen Spenden diese Veranstaltung unterstützten. Zur Aufführung erschien auch ein sehr liebevoll gestaltetes Bilderbuch, welches über den neu ins Leben gerufenen Online-Shop ProEthiopia zugunsten von MfM gut verkauft werden konnte.
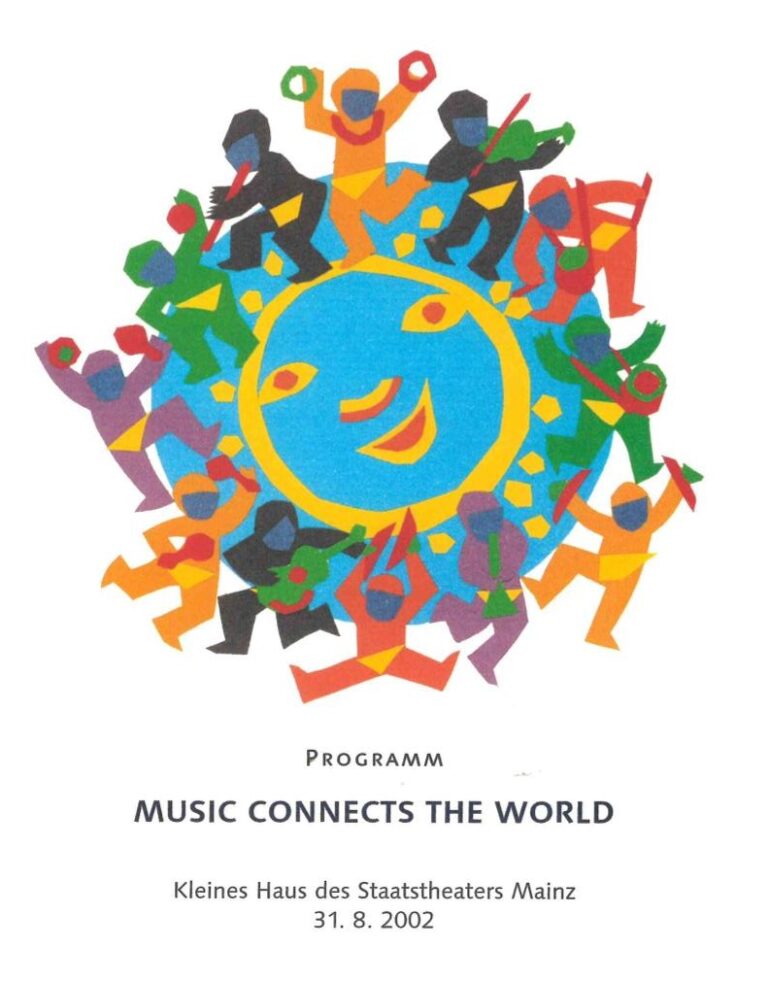
Ich hatte insgesamt noch zwei CDs mit Originalmusik aus Äthiopien auf eigene Kosten produzieren lassen. Besondere Freude machte mir die Produktion in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk in Frankfurt: Karlheinz Böhm liest Büchners Lenz. Für mich ist diese CD ein herrliches Zeugnis für die große schauspielerische Begabung von Karlheinz Böhm. Seine Interpretation ist ein ganz großer Genuss.
Wer sich das von Karlheinz Böhm erzählte Märchen anhören möchte, findet es hier: https://www.enjott.com/werke/ali-und-der-zauberkrug-ein-musikalisches-maerchen-fuer-kinder-nach-einem-afrikanischen-maerchen
Ein Benefizkonzert am 18. November 1996 war der Auftakt des Engagements von Dr. Peter Hanser-Strecker, Musikverleger des Verlags Schott Musik für die Stiftung Menschen für Menschen. Es war zusätzlich der Beginn einer intensiven Freundschaft mit Karlheinz Böhm. In den darauffolgenden Jahren war Dr. Hanser-Strecker erst Mitglied im Verein der Stiftung Menschen für Menschen, von 2003-2008 Mitglied des Vorstandes, von 2009-2011 Mitglied und Vorsitzender des Stiftungsrates, von 2011-2014 Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Seit 2014 ist er nun Mitglied des Stiftungsrats.
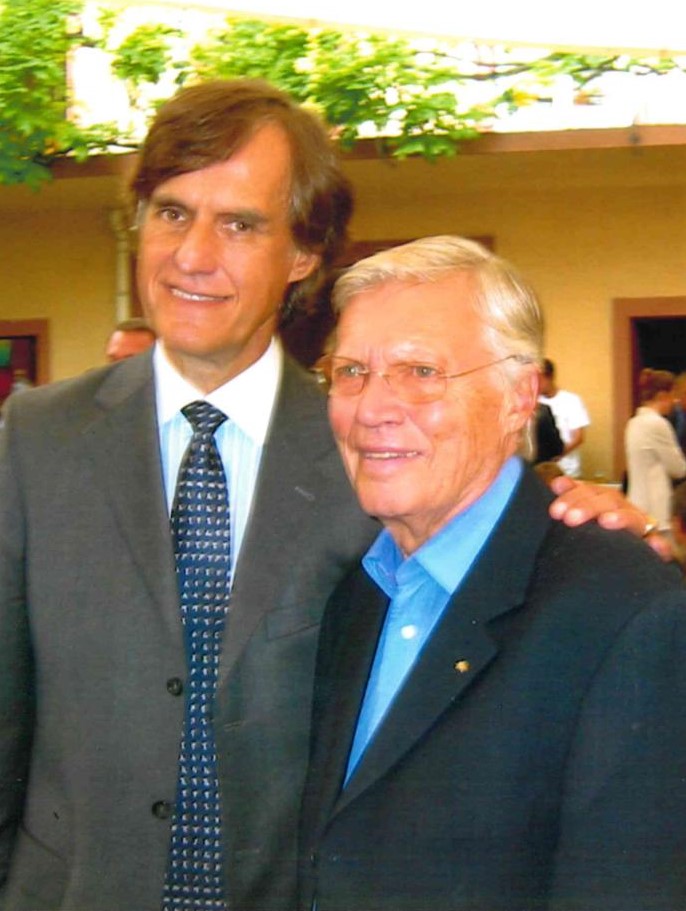
Ein Teil von Menschen für Menschen zu sein, mit all seinen lieben Menschen in München und auf der ganzen Welt, ist eine Lebensbereicherung. Mein schönstes Erlebnis aus inzwischen drei Jahrzehnten ehrenamtlichem Engagement ist das erste persönliche Treffen mit Karlheinz Böhm im Jahre 2006. Dieses Treffen war so prägend, seine Motivation für die Arbeit in Äthiopien so überzeugend, dass ich mich seitdem noch viel intensiver für die Stiftung engagiert habe.
Aber der Reihe nach: Schon immer haben mein Mann und ich ein bisschen was für den guten Zweck gespendet, doch dann wollten wir irgendwann mehr tun, uns selber ehrenamtlich engagieren. Dazu haben wir bei drei Organisationen, darunter auch die Stiftung Menschen für Menschen, angefragt, in welchem Rahmen ehrenamtliches Engagement möglich ist.
Der Beginn meines Ehrenamtes
Natürlich hatte ich 1981 die Wette Karlheinz Böhms gesehen, schließlich war „Wetten, dass…?“ eine absolute Kultsendung. Danach habe ich grob verfolgt, was Karlheinz Böhm vor Ort erreichte, wie aus der Wette eine richtige Organisation wurde, wie die Projektarbeit vor Ort immer mehr wuchs. Nachdem wir also drei Organisationen kontaktiert hatten, kam von MfM direkt ein tolles Informationspaket zurück, was uns überzeugt hat.
Wir fingen an, Foto-Ausstellungen zu gestalten, und im Laufe der Jahre organisierten wir regelmäßig viele und ganz unterschiedliche Veranstaltungen, je nachdem, was gerade passte, wie zum Beispiel Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt, Multi-Visionsschauen, oder ein Gala-Abend im Amberger Congress Centrum.
2006 bekam ich eine Einladung von MfM, an einem ihrer Ehrenamtstreffen in Nürnberg teilzunehmen. Zu diesem Treffen kam auch Karlheinz Böhm, den ich bis dahin nicht persönlich kennengelernt hatte. Ich stand bei den Gästen und wartete, bis ich an der Reihe war, Karl zu begrüßen. Tausend Gedanken schossen mir dabei durch den Kopf: „Sag ich ‚Grüß Gott‘ oder ‚Guten Tag‘ oder, oder, oder?“. Als ich dann an der Reihe war, nahm er mich in seine Arme und sagte schlicht und einfach: „Schön, dass du da bist.“
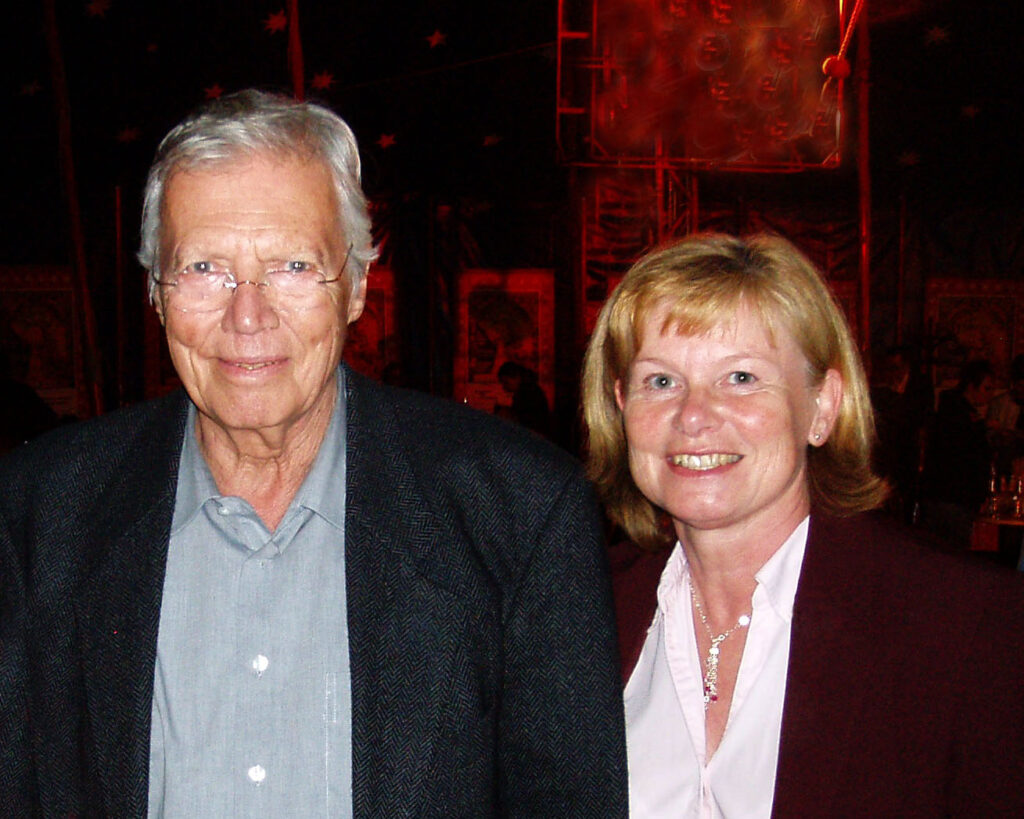
Diese Herzlichkeit im Umgang und dazu seine Bodenständigkeit waren einfach ehrlich und echt. Obwohl er ein sehr bekannter Schauspieler war, hat sich Karlheinz Böhm immer normal verhalten, war nicht überheblich, und sorgte dafür, dass man sich stets wohl in seiner Umgebung fühlte.
Ich finde, dass jeder Mensch aus seinem Lebensweg sehr viel mitnehmen kann. Die Tatsache, dass Karl schon 50 Jahre alt war, als er sein Leben umgekrempelt hat, zeigt doch, dass man nie zu alt ist, um einen neuen Weg zu gehen, etwas Neues auszuprobieren – auch wenn dies vielleicht am Anfang auf Widerstand stößt.
Die Erfüllung eines Herzenwunsches
Ein weiteres absolutes Highlight, was mich in meinem Engagement für die Stiftung immer motiviert und antreibt, war dann meine Reise nach Äthiopien im Jahr 2019. Schon immer war es ein Herzenswunsch von mir, mal nach Äthiopien zu reisen, doch mit meiner Familie und den Kindern kam immer irgendetwas dazwischen.
In einem Gespräch mit der Ehrenamtskoordinatorin der Stiftung, Melanie Koehler, meinte sie dann zu mir: „Heidi, wir packen das jetzt an!“ Sie hat sich unglaublich dafür eingesetzt, dass eine kleine Gruppe Ehrenamtliche in die Projektgebiete Borena und Wogidi reisen durfte. 2019 wurde mir dann dieser ganz große Wunsch erfüllt – schon bei der Erinnerung habe ich Gänsehaut bis in die Knöchel – ich bereiste das Land, sah die Projektarbeit von MfM vor Ort, lernte die Menschen und Kultur Äthiopiens kennen.

Mein Engagement für die Stiftung ist von diesen Erlebnissen, der Herzlichkeit Karlheinz Böhms und der Erfüllung meines Herzenswunsches – der Reise nach Äthiopien – geprägt. Sie haben mich von der Arbeit der Stiftung überzeugt, von den „Menschen für Menschen“ – etwas, wofür ich mich gerne auch noch viele weitere Jahrzehnte einbringe und ehrenamtlich engagiere.
Heidi Dolles-Birner ist seit 30 Jahren ehrenamtlich für Menschen für Menschen aktiv. Zwei Erlebnisse prägten ihr Engagement dabei ganz besonders.

1998 lud Karlheinz Böhm meinen Mann Loukas und mich ein, das Projektgebiet Merhabete zu besuchen. Freitagnachmittag nach dem Schulschluss – denn ich war an der Deutschen Schule in Addis tätig – ging‘s los.
Mit einem MfM-Fahrer holpern wir Richtung Norden. Die Gegend, rau und wild! Riesige Berge, deren Hänge manchmal 1.000 Meter in die Tiefe stürzen, rosafarbene glatte Felshänge, die der untergehenden Sonne versuchen Konkurrenz zu machen, breite Täler, die hier und da von traurigen Rinnsalen durchzogen werden. Auch die Straße stürzt sich in die Tiefe, der Wagen rattert und scheppert über Geröllhalden und durch Flüsse, dann ist der erste Reifenwechsel fällig. Der nächste folgt kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Mehr als zwei Ersatzreifen gibt’s auch nicht.
Vor uns auf einem Berg liegt Alem Ketema und die roten Dächer des MfM Gästehauses leuchten einladend. Erschöpft lassen wir uns das Abendessen schmecken, und besprechen mit Mr. Birhanu, dem Projektleiter von Merhabete, den morgigen Tag. Dann fallen wir ins Bett und lauschen dem einsetzenden Regen, der von allen erwartet wurde, hören den Donner und sehen die grellen Blitze hinter verschlossenen Lidern.

Mr. Birhanu, der Mann mit den glitzernden freundlichen Augen, begleitet uns am nächsten Morgen zu einer Hühnerfarm, wo gut legende Hühner für die Bauern aus dem Umland gezüchtet werden. Diese bekommen die Hühner jedoch nur, wenn sie für eine entsprechende Haltung in einem gemütlichen Hühnerhäuschen mit Stroh gedeckt gesorgt haben. So steht der Tukul des Bauern da, daneben ein kleines hübsches Hühnerhäuschen – Tukulstil. Ein riesiges überdachtes Wasserreservoir fängt das Regenwasser auf, leitet es in die großen Kammern und gewährt so die schwierige Wasserversorgung der Tiere und Menschen.
Eigeninitiative ist gefragt
Weiter rumpeln wir den Weg zu einem Neubau einer Schule. Wie die Lastwagen diesen Weg herunterkommen, bleibt mir ein Rätsel. In der Regenzeit transportieren die Esel und Maultiere geduldig das Material den Geröllpfad hinunter. Wir besichtigen die alte Schule – ein aus Hölzern zusammen gezimmerter Bau, wo in einem Raum auf der blanken Erde 120 Kinder unterrichtet werden – ein Raum so groß wie eine deutsche Normklasse.
Die neue Schule, deren Wände schon stehen, lässt Bestes erahnen. Die Leute erstellen die Schule in Eigenarbeit. Aus einem von MfM erbauten Brunnen schöpfen die Frauen das Wasser für den Zement in ihre Krüge. MfM stellt nicht einfach irgendetwas hin und die Leute können es benutzen, sondern Eigenarbeit und Eigeninitiative sind gefragt. Für mich der einzige Weg, von dem ich glaube, dass er funktioniert. Denn hat man selbst etwas erbaut, möchte man es in aller Regel behalten, gut behandeln und pflegen.
Nächster Halt: Baumschule
Der Wagen rüttelt uns zur Baumschule, in der Loukas am liebsten den Rest seiner Tage verbringen würde. Die Setzlinge werden günstig an die Farmer verkauft, die einen Teil des neuen Saatgutes an MfM wieder zurückverkaufen und einen Teil an andere Farmer verkaufen müssen. So wichtig sind Bäume hier, um die schnell fortschreitende Erosion aufzuhalten.

Wir sehen Steinwälle in kleinen Schluchten oder an Hängen, die helfen, die Erde aufzuhalten, die in der Regenzeit sonst weggeschwemmt wird und mit ihr die landwirtschaftliche Grundlage der Farmer. Eine Art Staudamm sorgt für Bewässerung der Felder. Und immer wieder müssen die Einheimischen bei jeder Art von Bau ihren Teil der Arbeit übernehmen. Es gibt nichts für umsonst. Auch die Regierung wird Stück für Stück in die Projekte einbezogen.
Fahrt über Berg und Tal
Am nächsten Tag geht es über Fels und Geröll in ein Tal, das auf 1.300 Metern liegt. Wir kommen aus einer Höhe von 2.250 Metern, und der Blick in den Abgrund rechts von mir lässt mich zurückschrecken. Unten angekommen, schlägt uns erbarmungslos die Hitze entgegen, obwohl es noch früh ist.
Immer wieder durchqueren wir auf unserem Weg den Fluss Wenchit, scheuchen Schwarzstörche auf, ärgern einen Hammerkopf, bewundern den vor uns flüchtenden Reiher mit seinen silbergrauen Schwingen. Aber noch mehr bewundern wir die Steinmauern, die durch mühevolle Arbeit und mit viel Kosten das Land vor dem Wegschwemmen bewahren. Wir wandern an einem von Menschen für Menschen angelegten Kanal entlang.
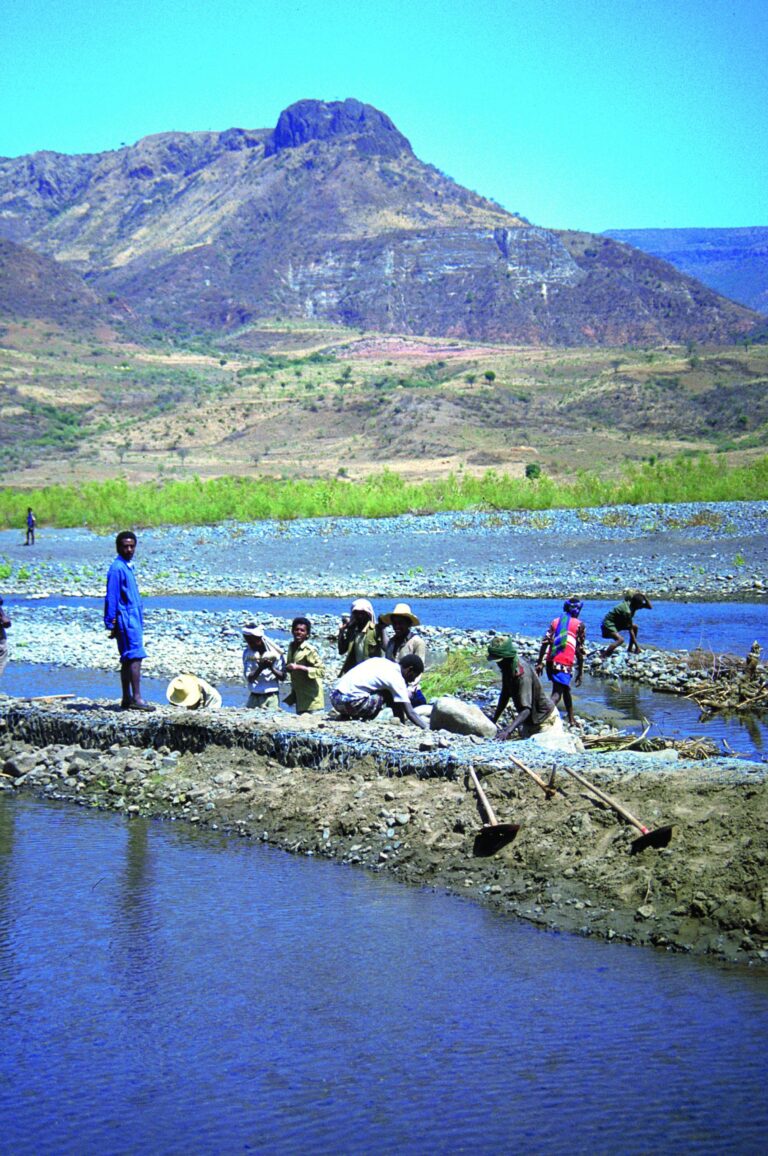
Besuch bei einem Modellbauern
Nachmittags besuchen wir auf einem strategisch bestens gelegenen Hügel einen gastfreundlichen Modellbauer, der mit Hilfe von MfM sein Häuschen auf bestimmte Weise anders als die üblichen Tukuls baute: Hütte aus Stein plus Lehm, eine Konstruktion, die die Abholzung von Bäumen vermeidet und die Steine vom Acker verschwinden lässt. Innen teilt sich dies Häuschen in zwei Räume, die durch eine dreiviertelhohe Lehmwand getrennt sind. Draußen das obligatorische Hühnerhüttchen, Winzighüttchen für Getreide und eine Toilette. Der Ausblick ist wahrlich königlich: die ganze Hochebene erstreckt sich vor uns, ein kühler sanfter Wind streichelt uns die Wangen, ein kleiner Hund die Waden.
Vieles könnte ich noch erwähnen, die fertige Schule, die Krankenstation, den Kindergarten, aber eins ist noch sehr wichtig: wir haben nicht nur bei MfM ausgesprochen liebe nette Menschen getroffen, sondern auch die oft sehr arme Bevölkerung war so freundlich und herzlich, dass jede Begegnung ein positives Erlebnis war.
Unsere Rückfahrt beginnt mit dem Anschieben unseres Nissans, da die Autobatterie leer ist. 15 Leute bemühen sich, diesen Koloss zum Laufen zu bringen. Es gelingt und diesmal ohne Reifenpanne erreichen wir Addis.
Brigitte Maniatis und ihr Ehemann Loukas zogen 1993 nach Addis Abeba, wo sie eine Stelle als Konrektorin an der Deutschen Botschaftsschule begann. Da Karlheinz Böhms Kinder an dieser Schule waren, entstand aus ersten Begegnungen bald eine enge Freundschaft, welche auch nach der Rückkehr von Brigitte und Loukas Maniatis nach Deutschland 1999 bestehen blieb. Die beiden engagieren sich bis heute auch ehrenamtlich für die Stiftung.

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre begleitete ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit Karlheinz Böhm zu fast allen Veranstaltungen und Terminen in Nordrhein-Westfalen.
Ein Abend ist mir in besonders lebhafter Erinnerung geblieben. Udo Jürgens hatte 1988 auf seinem „Blauen Album“ den Titel „Gehet hin und vermehret Euch“ veröffentlicht, mit dem er den Papst und die Haltung der katholischen Kirche zur Empfängnisverhütung kritisierte und diese mitverantwortlich für die Situation in der „Dritten Welt“ und die – wie er es nannte – „Überbevölkerung“ machte. In einem Zeitungsinterview hatte er sich darüber hinaus kritisch zur Entwicklungszusammenarbeit geäußert und indirekt auch Karlheinz Böhm angesprochen.
Udo Jürgens war zu jener Zeit deshalb in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast, unter anderem 1988 in der WDR-Talkshow „Ich stelle mich“ mit dem seinerzeit sehr populären Moderator Claus Hinrich Casdorff, die live im ersten Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde. Eine Besonderheit dieses Formats war immer ein Überraschungsgast, dessen Name dem Talkgast zuvor nicht bekannt gegeben wurde und mit dem der Talkgast dann eine Art Streitgespräch zu führen hatte. Für Udo Jürgens war dieser Überraschungsgast Karlheinz Böhm.

Karlheinz bat mich, ihn ins Funkhaus in Köln zu begleiten. Er war ganz schrecklich aufgeregt und sah sich in der Verteidigungsposition, nachdem Udo Jürgens ihn indirekt angegriffen hatte. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Außerdem hatte er großen Respekt vor der Situation, in einem Studio voller leidenschaftlicher Udo-Fans deren Idol angreifen zu müssen.
Und so brachte er bei dem Gespräch mit Udo Jürgens vor laufender Kamera in kürzester Zeit mehr oder weniger ungeordnet alle möglichen Argumente zur Sprache, die ihm in dem Moment wichtig waren und gerade einfielen. Es war kein Streitgespräch im klassischen Sinne eines Dialogs, Karlheinz redete praktisch allein und schlug sich trotz seiner Nervosität wacker.
Überraschende Aufgabe für Jürgens
Zum Abschluss der Sendung sollte Udo Jürgens noch ein Lied singen, aber keines von seinem aktuellen Album, sondern – das war die zweite Überraschung für ihn – ein spontan komponiertes Lied. Hierzu präsentierte ihm Claus Hinrich Casdorff ein Gedicht von Heinrich Heine und gab ihm zur Aufgabe, es zu vertonen. Udo Jürgens setzte sich also an seinen berühmten Plexiglas-Flügel, komponierte ad hoc eine recht eingängige Ballade und trug sie den Zuschauern vor. Große Begeisterung beim Publikum, Abmoderation der Sendung, Applaus, Ende der Vorstellung.
Ich war und bin ein begeisterter Hobbypianist. Auf dem Weg nach Köln hatte ich Karlheinz eher beiläufig erzählt, dass ich sehr gern mal auf dem Plexiglas-Flügel von Udo Jürgens spielen würde. Karlheinz überraschte mich in der für ihn so typischen Art damit, dass er Udo Jürgens unmittelbar nach der Sendung – das Publikum war noch im Studio – bat, mich an seinem Flügel spielen zu lassen. Dazu muss man noch wissen, dass ich über die besondere Begabung verfüge, nahezu jedes Stück nach Gehör ohne Noten spielen zu können. Ich setzte mich also an das Instrument und spielte, weil ich sie noch im Ohr hatte, die soeben von Udo Jürgens frisch komponierte Ballade.
Die übrigen Anwesenden waren verblüfft. Casdorff machte Udo Jürgens heftige Vorwürfe: Jürgens habe ihn und die Zuschauer betrogen, er habe doch ein neues Lied ad hoc komponieren sollen und nicht einfach ein schon vorhandenes Stück spielen dürfen. Sonst könne es ja wohl nicht sein, dass „irgendjemand aus dem Publikum“ das Stück zu spielen vermochte. Nun war plötzlich Udo Jürgens derjenige, der in der Verteidigungsposition war. Er „schwor bei seiner Ehre“, dass es sich bei der von ihm in der Sendung komponierten Ballade um ein vollständig neues Stück handelte, ich könne das unmöglich gekannt haben. Ein Wort folgte dem anderen. Nun gab es also doch noch ein echtes Streitgespräch an diesem Abend!
Virtuoses Duett mit einem Entertainer
Wir schauten dem Treiben eine Weile amüsiert zu und Karlheinz Böhm löste das Rätsel dann irgendwann auf. Claus Hinrich Casdorff wollte das nicht glauben und forderte mich auf, all das nachzuspielen, was Udo Jürgens auf dem Flügel vorspielen würde. Und so kam es, dass wir beide dann – in meiner Erinnerung fast eine Stunde lang – zahlreiche Titel aus seinem Repertoire gemeinsam am Flügel spielten: Jürgens zu vier Händen.
Die Kameras waren schon aus und Smartphones gab es 1988 natürlich noch nicht. Deswegen gibt es leider kein Bild- oder Tondokument von diesem Abend, bei YouTube ist nur ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung verfügbar, in dem Udo Jürgens die Ballade singt (siehe hier). Es war ein großer Spaß! Auf dem Rückweg aus Köln war Karlheinz Böhm ganz aufgekratzt und strahlte mich an: „Dem Jürgens haben wir beide heute Abend ordentlich eine verpasst!“
Stephan Altenburg unterstützt die Stiftung seit der ersten Stunde – um genau zu sein, sogar schon seit dem Tag vor Karlheinz Böhms Wette. Als Schüler startete er eine große Spendenaktion und war dann lange ehrenamtlich der Regionale Ansprechpartner von Menschen für Menschen in Nordrhein-Westfalen, bevor er 1989 zum Jurastudium nach München ging und im Anschluss eine erfolgreiche Anwaltskanzlei aufbaute.

Wer einmal in Äthiopien der offiziellen Eröffnung einer Wasserstelle, Krankenstation oder Schule beigewohnt hat, der wird nie vergessen, mit welcher die Begeisterung die lokale Bevölkerung das gemeinsam Erreichte im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten feiert: Zu Hunderten und Tausenden kommen sie aus den umliegenden Gemeinden zusammen, um mit Reden, Gedichten, Segenssprüchen, Musik, Tanz und hausgemachten Speisen ihre Verbundenheit mit dem Team von Menschen für Menschen zum Ausdruck zu bringen.
Für die Ehrengäste – wie z.B. die Spender und Spenderinnen und Sponsoren einzelner Maßnahmen – gibt es als Erinnerung an den besonderen Tag und als Anerkennung für den Beitrag zum Fortschritt oft auch spezielle Geschenke. Die Empfänger und Empfängerinnen sind dann immer sehr gerührt ob der herzlichen Geste und versuchen, ihre Freude auszudrücken, so gut es ohne Sprachkenntnisse eben geht.
Ein dankbarer Karlheinz Böhm
Nie aber habe ich in all den Jahren als PR-Referentin in Äthiopien jemanden erlebt, der die Wertschätzung so eindrücklich erwidert hat wie Karlheinz Böhm. Zwar erhielt er sehr oft diverse Gaben, die dann letztendlich entweder als Dekorationsgegenstände die Gästehäuser in unseren Projekten schmückten oder aber – sofern es sich um Hühner, Schafe oder Ziegen handelte – für ein gemeinsames Abendessen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geopfert wurden.

Den Augenblick der Übergabe aber zelebrierte Karlheinz Böhm. Nach dem Auspacken würdigte er die Geschenke nicht nur ausführlich mit seinen Blicken, sondern nahm ganz genau wahr, was man ihm geschenkt hatte. Er zollte seinen Respekt, indem er alles dem jeweiligen Zweck entsprechend vor der versammelten Menge benutzte: Honig wurde genüsslich gelöffelt, Messer zum Schneiden von Brot verwendet und bei der Eröffnung des großen Krankenhauses in Maichew (Tigray) 2002 ging er mit mir zusammen in die neuen Verwaltungsräume, damit wir die traditionellen Kleidungsstücke und Tücher überziehen und so für den Rest der Fest-Veranstaltung auch durch unser Outfit demonstrieren konnten, dass wir uns als Teil der lokalen Bevölkerung verstanden.


Im westäthiopischen Illubabor, wo wir rund 25 Jahre intensiv und umfangreich tätig waren, bekam Karlheinz Böhm während einer Schul-Einweihung sogar ein besonders schön geschmücktes Pferd überreicht. Wohl wissend, was für stolze Reiter die Männer der Region waren und was für eine besondere Auszeichnung ihm hier zu Teil wurde, bemühte er sich trotz seiner 75 Jahre und ohne den üblichen Sattel, auf das schöne Tier hinauf zu kommen. Jeder konnte sehen, dass es ihm nicht leichtfiel, und wusste umso mehr zu schätzen, dass er dem Geschenk gebührende Ehre erwies. Das Pferd sollte später noch viele Jahre lang die Kinder im Abdii Borii-Heim erfreuen.
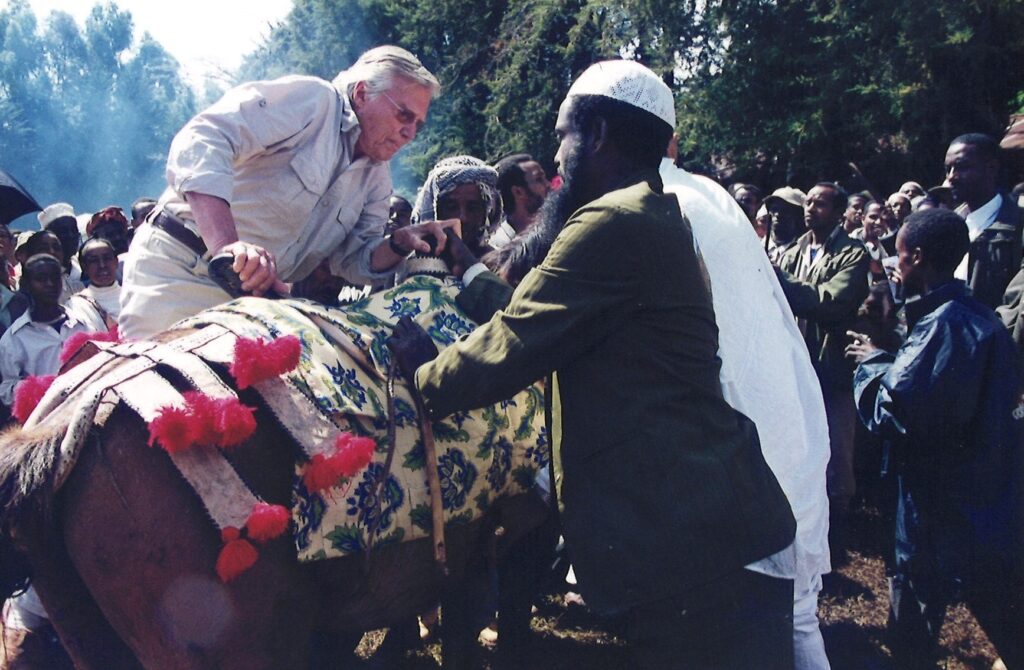
Aber nicht nur Präsenten und Schenkenden gegenüber zeigte Karlheinz Böhm stets adäquate Wertschätzung. Auch andere Menschen, denen er in Europa oder Äthiopien bei Veranstaltungen oder in ihrem Alltag begegnete, spürten – ebenso wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – die enorme Präsenz, mit der er jede Situation erfasst und die anwesenden Personen individuell wahrgenommen und wohlwollend einbezogen hat.
Michaela Böhm kam bereits 1984 als ehrenamtliche Helferin zu Menschen für Menschen und arbeitete bald schul- bzw. studienbegleitend in der PR-Abteilung mit. Anschließend wurde sie in Vollzeit von der Stiftung übernommen und war – mit Ausnahme von ein paar Jahren in anderen Unternehmen – zwei Jahrzehnte als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit sowie als persönliche Assistentin von Karlheinz und Almaz Böhm im Einsatz, u.a. auch mehrere Jahre in Äthiopien. Seit 2014 unterstützt sie den Vorstand und Stiftungsrat von MfM-Deutschland.

Eine Reise nach Äthiopien ist etwas ganz Besonders. Auch für langjährige Mitstreiter:innen bei Menschen für Menschen. So kam auch ich erst 2005 erstmals nach Äthiopien – nach über 20 Jahren „Schreibtisch-Engagement“ eine bewegende, ja überwältigende Erfahrung. Zumal ich Karlheinz Böhm durch die Projektgebiete begleiten durfte. Erstmals schilderte mir der Stiftungsgründer seine Erfahrungen direkt vor Ort. Und zeigte mir auf dieser Reise, wie er die Grundsätze unserer Stiftungsarbeit in Äthiopien umsetzt und lebt.

Seine prinzipielle Zurückhaltung, mit zu vielen deutschen Besucher:innen in die Projektgebiete zu reisen, erklärte sich jetzt. Denn groß war seine Sorge, dass die Betreuung von Gästen die Teams vor Ort von ihrer eigentlichen Arbeit abhalten könnte. Wegen dieses Grundsatzes hatte sich auch für mich eine Äthiopien-Reise trotz unserer intensiven Zusammenarbeit in Deutschland erst jetzt ergeben, als ich zum Vorstand bestellt worden war. Endlich konnte auch ich selber die Faszination des Landes erleben – mit wachsender Begeisterung für die Wirksamkeit unserer Projekte!
Beginn der Reise - und schon kam alles anders
Am 26. Oktober 2005 landete ich – ziemlich aufgeregt und voller Spannung – am Flughafen in Addis Abeba, zusammen mit Heide Dorfmüller aus dem Stiftungsrat. Michaela Böhm als MfM-Frau der ersten Stunde, damals PR-Referentin vor Ort, holte uns ab. Schon auf dem Weg zum Hotel erlebten wir die praktische Auswirkung eines weiteren Grundsatzes: Spontaneität und Flexibilität. Das geplante Reise-Programm war völlig umgestellt worden! Typisch für Karlheinz Böhm, der auch selbst ständig seine Reiseroute kurzfristig abänderte. Denn er wollte ungeschönte Eindrücke und Authentisches erleben, um die alltägliche Projektarbeit, gerade auch mit deren Schwierigkeiten zu erfahren.
Es war ihm geradezu ein Ärgernis, dass ihm überall die positiven Highlights seit seinem letzten Aufenthalt präsentiert wurden. Dies wollte er vermeiden, obwohl er verstand, dass MfM-Team und Bevölkerung stolz auf alles neu Erreichte waren und ihre Freude mit ihm teilen wollten. Für Karlheinz Böhm war es vor allem immer ein Anliegen, genau zu verstehen, wo und warum es Probleme gab. Um dann gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Es war seine gelebte Überzeugung, dass nur in diesem stetigen Lernprozess ein wirklich funktionierendes Konzept für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit entstehen kann.
Die Entstehung neuer Projektgebiete
So wurde unsere Fahrt in die bereits langjährig und erfolgreich laufenden Projektgebiete im Osten des Landes (ATTC und Babile) kurzerhand an das Ende der Reise verschoben. Stattdessen brachen wir am nächsten Morgen Richtung Norden auf, zusammen mit Karlheinz Böhm, dem damaligen Landesrepräsentanten Berhanu Negussie, dem Projekt-Koordinator Dr. Martin Grunder und dem Projektleiter Demerre Anno – allesamt mit langjähriger Erfahrung bei Menschen für Menschen. Das war wichtig, denn wir fuhren in die Distrikte Asagirt und Hagere Mariam, die schon seit längerem um Unterstützung gebeten hatten. Immer wenn es für MfM finanziell möglich war, sich in weiteren Projektgebieten neu zu engagieren, war es für Karlheinz Böhm ein wichtiger Grundsatz, sich erst selbst ein Bild von der Lage dort zu machen. Damit das finanzielle Engagement von MfM auch zu einer wirkungsvollen Entwicklungszusammenarbeit führen kann.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Partizipation und Eigenverantwortung waren für Karlheinz Böhm nicht nur leere Worthülsen, sondern auch im Alter von 77 Jahren überzeugend gelebte Realität. Entsprechend besuchten wir in den nächsten Tagen die offiziellen Vertretungen der Bezirke. Karlheinz Böhm und sein Team hörten immer zu – voller Aufmerksamkeit. Danach folgten stundenlange Diskussionen. Sogar wenn es in den einfachen Verwaltungsgebäuden teilweise so stickig war, dass uns als Gästen im wahrsten Sinne des Wortes die Luft wegblieb. Da fiel dann schon mal eine europäische Mitreisende kurzerhand in Ohnmacht. Aber so ein kurzer Schwächeanfall war schließlich nur vorübergehend. Unsere Projekte jedoch sollten von dauerhafter Wirkung sein.
Gemeinsam: auf Augenhöhe, mit Geduld und Vertrauen
Auch völlig unzureichende Schulgebäude und menschenunwürdige Krankenstationen ließen wir uns von den zuständigen Behörden zeigen. Und der ländlichen Bevölkerung begegneten wir nicht nur zufällig auf der Straße oder auf den kargen, steinigen Feldern. Mit Karlheinz Böhm besuchten wir zahlreiche Bauern auch zuhause auf ihren kleinen Höfen. Die Familien schenkten uns ihre herzliche Gastfreundschaft und teilten großzügig das Wenige, das sie hatten. Vor allem schenkten sie uns ihr Vertrauen – froh darüber, dass jemand ein offenes Ohr für ihre vielfältigen Sorgen und Nöte hatte. Und natürlich auch voller Hoffnung, weil sie gehört hatten, was die Menschen in anderen Landesteilen zusammen mit MfM bereits schon erreichen konnten. Nun standen sie bereit und wollten alles tun, um mit unserer Hilfe auch für sich, ihre Kinder und ihre Region eine gesicherte Zukunft aufzubauen.


Hierfür braucht es Geduld und Zeit, bis fundierte Projektpläne erstellt und Verträge mit den zuständigen Behörden verhandelt sind, gerade auch wegen der damals politisch unruhigen Phase im Nachgang zu den landesweiten Wahlen in Äthiopien.
So war bei unserem Rückflug am 4. November 2005 noch keinesfalls absehbar, ob und wann MfM in Asagirt und Hagere Mariam tätig werden würde. Doch es war ein Grundsatz von Karlheinz Böhm, solche Entscheidungen unbeirrt von äußeren Umständen zu treffen, politisch neutral und ausschließlich am Bedarf der Menschen vor Ort orientiert. Schließlich konnte MfM auch in diesen Gebieten von 2007 bis 2015 mit der Projektarbeit einen umfangreichen Beitrag leisten. Allein in diesen beiden Projektgebieten haben sich so die Lebensumstände und Perspektiven von rund 115.000 Menschen verbessert. So kann eine Reise nach Äthiopien deutliche Folgen haben. Für mich persönlich jedenfalls hat sich Faszination für Menschen und Land noch vergrößert. Genauso wie mein überzeugtes Engagement für Menschen für Menschen.
Dr. Martin Hintermayer ist fast von Anfang an bei MfM dabei: seit 1984 als juristischer Berater noch beim ursprünglichen Verein, später im Stiftungsrat. Seit 2005 engagiert er sich als Mitglied des Vorstands der Stiftung Menschen für Menschen.

Vor 20 Jahren war ich als medizinischer Koordinator im Mettu Karl Krankenhaus, in der Projektregion Illubabor, tätig. Wie es im Zeitplan von Karl üblich war, besuchte er alle drei Monate die Projekte in Äthiopien, darunter auch das Krankenhaus. Vor seinem Besuch in Illubabor fuhr er ins Erer-Tal, nach Babile und in weitere Projektgebiete, die endemisch für Malaria sind.
Bei seiner Ankunft im Krankenhaus bei uns in Illubabor bekam er Fieber, Kopfschmerzen und fühlte sich generell sehr unwohl – natürlich hatten wir Sorge, dass es Malaria sein könnte. Er kam zur Blutfilmuntersuchung in den Laborteil des Krankenhauses. Bei seiner Ankunft dort traf er auf viele Menschen im Wartebereich, die für verschiedene Untersuchungen anstanden.
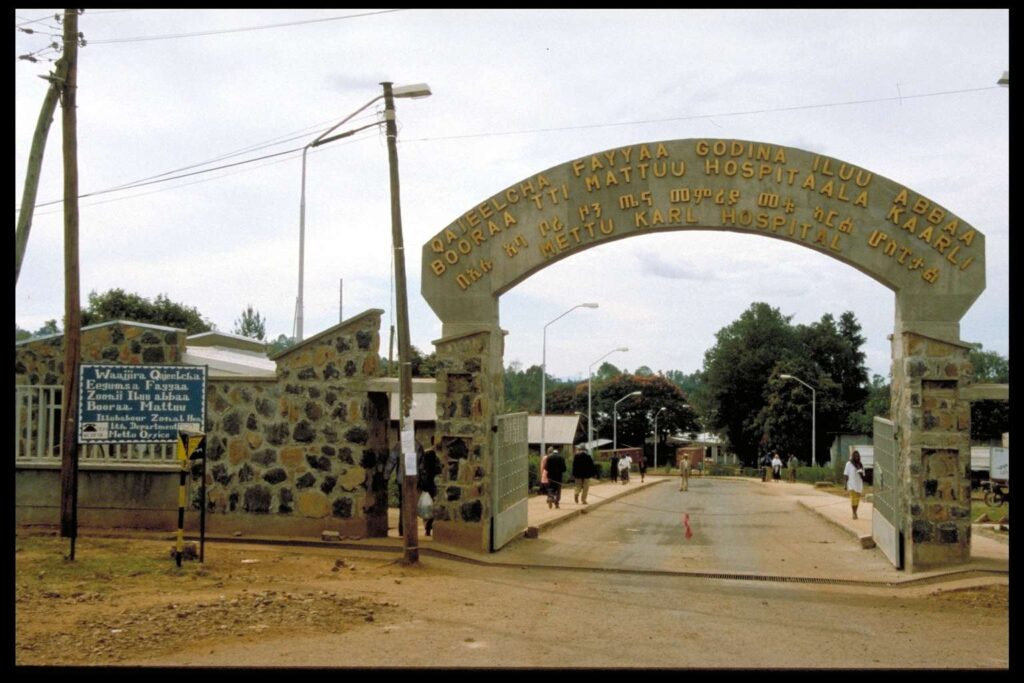
Er bat mich, den Patientinnen und Patienten folgendes in der lokalen Sprache zu sagen: „Ich weiß, dass Sie alle auf den Labordienst warten, für den ich auch komme; normalerweise muss ich mich mit Ihnen anstellen und den Dienst erst dann in Anspruch nehmen, wenn ich an der Reihe bin. Aber wie Sie sehen, bin ich sehr krank und muss noch einige Projektgebiete besuchen, bevor ich wieder nach Hause fahre. Aus diesen Gründen bitte ich Sie Entschuldigung für den Regelverstoß und um Erlaubnis, den Labortest ohne Anstehen zu bekommen.“


Ich übersetzte seine Worte und die Rührung und der Respekt, der sich in den Gesichtern der Patientinnen und Patienten spiegelte, wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Zweierlei Dinge zeigen hier die Persönlichkeit und die menschlichen Werte von Karl.
Erstens war er der Meinung, dass alle Menschen, die in das Krankenhaus kommen, die gleichen Rechte haben und er sich nicht von einer oder einem der Patientinnen und Patienten unterscheidet. Und dies, obwohl er selbst das Krankenhaus gebaut und später renoviert hat. Zweitens zeigt diese Geschichte den Respekt, den er in jeder Interaktion allen Menschen entgegenbrachte, wo auch immer er war, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, egal ob reich oder arm.
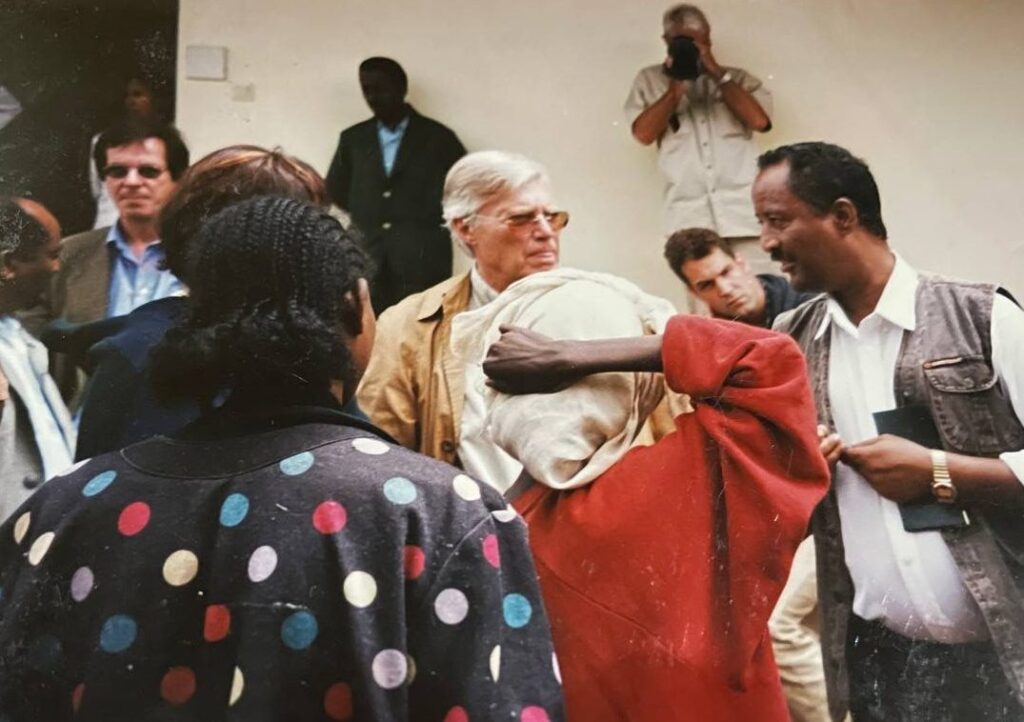
Dr. Asnake Worku, von Beruf aus Arzt, ist seit mehr als 20 Jahren für die Stiftung in Äthiopien tätig. Er fing im Mettu Karl Krankenhaus als medizinischer Koordinator für MfM an, arbeitete später in verschiedenen Positionen im PCO (Project Coordination Office) und ist derzeit stellvertretender Landesrepräsentant.

Von jüngster Jugend an war ich ein großer Anhänger von Albert Schweitzer. Mich hatte sein Leben, seine Interessen, sein Orgelspiel und vor allem seine Tätigkeiten in Afrika, speziell in Lambarene, besonders fasziniert. Als ich in den neunziger Jahren von einer schweren Auto-Immunkrankheit geheilt wurde, sah ich die Zeit als gekommen an, mein zum zweiten Mal geschenktes Leben verstärkt für einen guten Zweck einzusetzen.
Ich hatte die Aktivitäten von Karlheinz Böhm nach seinem Auftritt in der Sendung „Wetten, dass…?“ aufmerksam verfolgt und mir in den Kopf gesetzt, dass ich ihn und seine Vision gerne persönlich kennenlernen wollte. Im Jahre 1996 rief ich daher in München bei MfM an und bat um ein Gespräch mit dem damaligen Leiter der Fundraising-Abteilung Axel Haasis. Ihm verdanke ich es ganz besonders, dass mein Plan, Karlheinz Böhm persönlich kennenzulernen, so gut und so schnell aufging. Zur damaligen Zeit war ich Präsident des Rotary Clubs Mainz und konnte relativ leicht meine Freunde für ein Engagement für die Stiftung Menschen für Menschen gewinnen.
Mein Plan ging auf: Benefizkonzert im Kaiserdom
Aber ich musste ja erst einmal Karlheinz Böhm selbst kennenlernen und ihm unser mögliches Engagement näherbringen. Mit Haasis zusammen hatten wir bald einen wirkungsvollen Plan ausgeheckt. Warum nicht gleich mit einer Benefizveranstaltung beginnen – und diese an einer traditionsreichen Stelle, nämlich im Kaiserdom zu Worms, organisieren?
Zusammen mit dem damaligen Leiter des Erbacher Hofs suchten wir nach besonderen Texten, die Karlheinz Böhm mit seiner so herrlich klaren Stimme vortragen konnte und die nicht einen zu engen religiösen Hintergrund hatten. Der Plan wurde in die Tat umgesetzt, das Benefizkonzert fand am 18. November 1996 statt.
Die verschiedenen Texte wurden künstlerisch von dem Cello Ensemble meines guten, engen Freundes Berger begleitet, der Titel der Veranstaltung hieß „Vom Licht ins Dunkel“. Das Konzert wurde aufgezeichnet und so entstand dann auch gleich die erste Benefiz-CD von mir. Der Abend in dem bereits im Inneren recht dunklen Wormser Dom hatte seine Wirkung nicht verfehlt.
Wie aus Wut Freundschaft wurde
Am nächsten Tag war Karl eingeladen zu einem rotarischen Mittagessen, wo insgesamt die Mitglieder von drei Clubs versammelt waren. Dort hielt er einen unvergessenen und tief aufrüttelnden Vortrag über sein gerade begonnenes Lebenswerk.
Seinen Vortrag begann er in dieser Zeit oft mit dem Wort mit den drei Buchstaben: WUT. Wut über die Gleichgültigkeit, über die Ungerechtigkeit und über die wahren Nöte in dieser unserer Welt. Anhand von vielen persönlichen Erlebnissen, besonders auch in der Sahelzone, hat er viele von uns derart ergriffen, dass wir am Ende seines Vortrages buchstäblich sprachlos waren.
Ich machte den vergeblichen Versuch, ihm für sein Kommen und seinen Vortrag zu danken. Aber ich war in diesem Moment noch so tief bewegt, dass ich zu Weinen anfing. Als Karl das sah, stand er rasch auf und ging auf mich zu und umarmte mich lange und sehr herzlich.
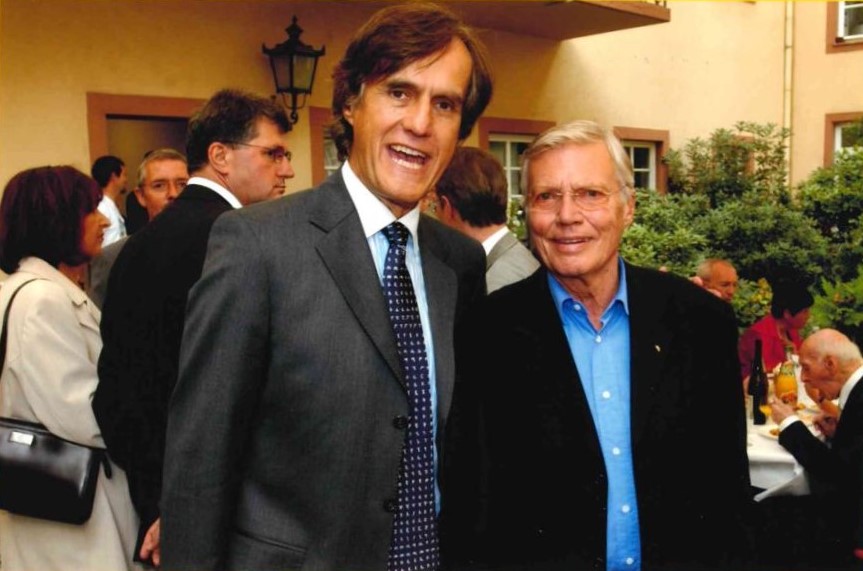
Es war sicher die schönste Umarmung von einem so besonderen und bekannten Mann, die mir je widerfahren ist. Aber mit diesem Erlebnis fing unsere so intensive Freundschaft eigentlich erst an. Sie hat uns im Laufe der Jahre gegenseitig viele, viele schöne Erlebnisse gebracht, bei denen auch die Musik eine große Rolle spielte, wie bei der Welturaufführung der Kinderoper Ali und der Zauberkrug in Mainz 2002 anlässlich meines 60. Geburtstages.
Ein Benefizkonzert am 18. November 1996 war der Auftakt des Engagements von Dr. Peter Hanser-Strecker, Musikverleger des Verlags Schott Musik für MfM. Es war zusätzlich der Beginn einer intensiven Freundschaft mit Karlheinz Böhm. In den darauffolgenden Jahren war Dr. Hanser-Strecker erst Mitglied im Verein von MfM, von 2003-2008 Mitglied des Vorstandes, von 2009-2011 Mitglied und Vorsitzender des Stiftungsrates, von 2011-2014 Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Seit 2014 ist er nun Mitglied des Stiftungsrats.
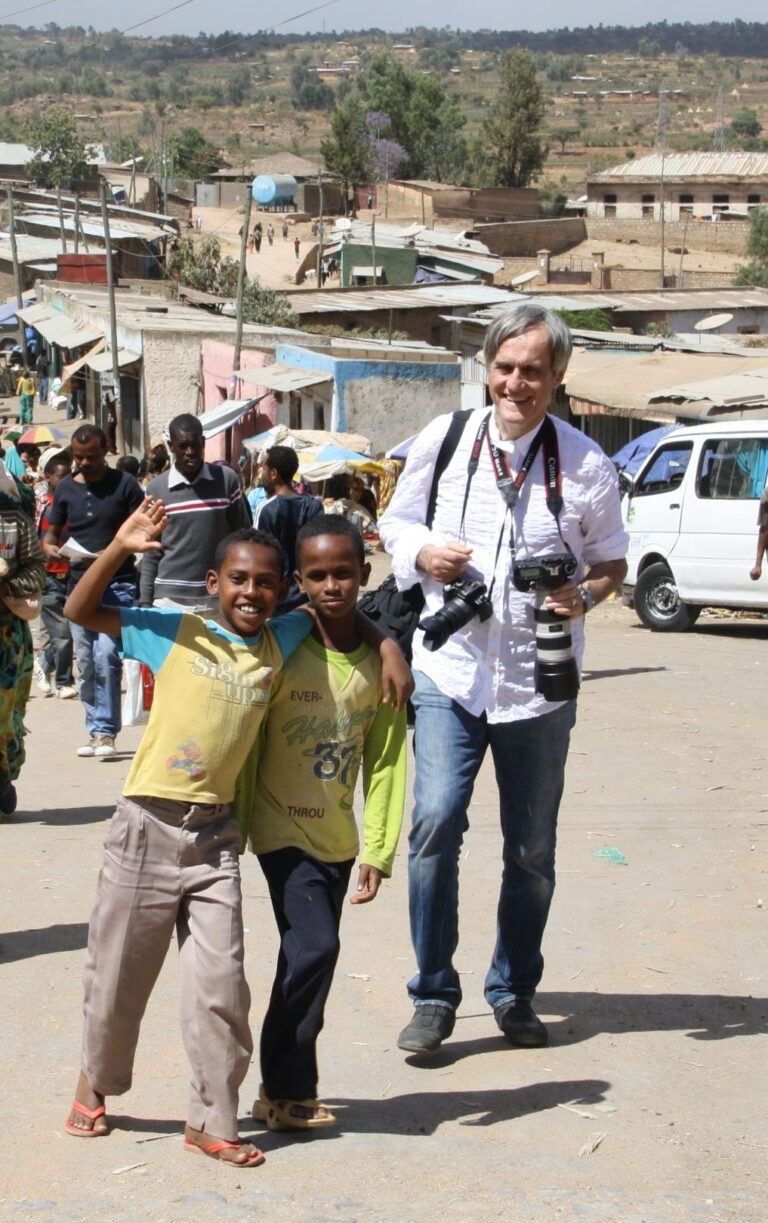
Dies ist die Geschichte einer Schulaktion, die wohl beispiellos ist. Obwohl – es ist nicht die Geschichte einer Schule, sondern die des „Schulzentrums Am Heimgarten“ in Ahrensburg, in dem zunächst drei Schularten (Hauptschule, Realschule, Gymnasium), seit 2006 zwei Schulen, das „Eric-Kandel-Gymnasium“ und die „Gemeinschaftsschule Am Heimgarten“, untergebracht sind.
1993 wurde ich als neuer Leiter der Realschule im Schulzentrum eingeführt. Zu Beginn meiner Tätigkeit informierten mich meine beiden Schulleiterkollegen über einen Spendenlauf des Gymnasiums für die Stiftung Menschen für Menschen. In diesem Zusammenhang würde deren Gründer, Karlheinz Böhm, unser Gast sein und ihm würde ein Scheck über 3.500 DM überreicht werden.
Von der Idee zur Umsetzung
Diese Begegnung mit Karlheinz Böhm, den ich während des Besuches begleitete und mit dem wir drei Schulleiter anschließend noch in kleiner Runde sprechen konnten, beeindruckte mich außerordentlich. Während des Gesprächs entstand die Idee der Spendenlaufaktion, in der alle Klassen der drei Schularten die Gelegenheit bekommen sollten, gemeinsam teilzunehmen. Ich erklärte mich spontan dazu bereit, dies federführend zu planen und umzusetzen.
Das bedeutete: Aus einer einfachen, wenig strukturierten Aktion eine durchorganisierte Veranstaltung zu entwickeln, damit möglichst viele der etwa 1200 Schülerinnen und Schüler (natürlich freiwillig) an einem Vormittag laufen konnten, dazu die Runden zu zählen und das Ergebnis zu dokumentieren. Neben diesem rein sportorganisatorischen Aspekt musste der eigentliche Zweck der Veranstaltung – Sponsorensuche vor dem Lauf, Geld einsammeln nach dem Lauf und anschließend Abgabe in der Schule – bedacht werden.

Ein Name für diese Aktion war schnell gefunden, denn 1994 stellten unsere drei Schulen erstmals den Antrag zur Anerkennung als UNESCO-Projekt-Schulen – so heißt der Lauf seitdem „Unescolauf“.
Nach einem Jahr waren dann die notwendigen Abläufe so optimiert, dass die eingesammelten Beträge beständig stiegen. Nach 3650 DM (1996) wurde es 1997 erstmals fünfstellig, ein Scheck über 13.600 DM konnte überreicht werden. Selbst die Währungsumstellung änderte nichts daran, die Beträge blieben fünfstellig und in jedem Jahr werden mittlerweile über 20.000 € „erlaufen“.
1999 erhielten alle drei Schulen die Ernennungsurkunde zur „anerkannten Unesco-Projektschule“. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden sämtliche Beträge an MfM überwiesen. Jetzt wurde es nötig – angesichts der ständig steigenden Summen aber auch möglich –, über die Kriterien der Vergabe der Gelder nachzudenken. Seitdem wird im Sinne von „regional – europäisch – global“ entschieden. Grundsätzlich verpflichteten sich die Schulen, zunächst Menschen für Menschen (global) jährlich mit 10.000€ des erlaufenen Geldes zu bedenken. Über viele Jahre unterstützten wir dann ein Waisenkinderprojekt in Rumänien (europäisch) mit 5.000 €, einen gewissen Teil benötigten wir für die UNESCO-Arbeit innerhalb des Schulzentrums und der Rest dann situationsabhängig zumeist einmalig in Form einer Soforthilfe innerhalb Deutschlands (regional) vergeben.
Der Spendenlauf als Teil unserer Schulidentität
Wir sind froh und dankbar, dass aus diesem zarten Pflänzchen ein starker Baum geworden ist. Unsere Schülerinnen und Schüler identifizieren sich über diesen, stets in der dritten Septemberwoche stattfindenden Lauf mit ihrer Schule und die Ergebnisse macht alle Beteiligten glücklich und stolz. Die „Siegerehrungen“ im Forum unseres Schulzentrums kurz vor den Weihnachtsferien mit 400 Schülerinnen und Schülern, teils illustren Gästen wie Sara Nuru und den Killerpilzen und MfM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – an dieser Stelle ein besonderer Dank an Joachim Gröger – waren stets Highlights des Schuljahres.

1984 startete eine einzelne Klasse damit, die Äthiopienhilfe durch einen Spendenlauf mit etwa 300 DM zu unterstützen – seitdem konnten Schülerinnen und Schüler des „Schulzentrums Am Heimgarten“ in Ahrensburg in den zurückliegenden 37 Jahren durch ihr Engagement einen Gesamtbetrag von etwa 250.000 € an Menschen für Menschen überweisen. Dabei habe ich auch schon die – noch nicht endgültige – Summe von unserem letzten Spendenlauf vor ein paar Wochen mit eingerechnet. Zum 30-jährigen Jubiläum hatten wir noch etwas „draufgelegt“ (12.500 €), dieses Mal war die Motivation noch größer, und ich denke, dass mindestens 20.000 Euro dabei rausspringen werden.
Mein größter Wunsch aber ist, dass Menschen für Menschen so weitermachen kann, wie in den vergangenen 40 Jahren – und mein zweitgrößter, dass zum 50-jährigen Jubiläum 2031 unser Schulzentrum immer noch als verlässlicher Spender dabei ist.
Heiner Bock war von August 1993 bis Februar 2016 Schulleiter am „Schulzentrum Am Heimgarten“ in Ahrensburg, Schleswig-Holstein. Schon 1984 startete dort eine einzelne Klasse einen Spendenlauf für die Menschen für Menschen, seit 1993 und bis heute koordiniert Heiner Bock den Spendenlauf für das gesamte Schulzentrum. 2017 besuchte er im Rahmen einer Reise für Ehrenamtliche auch die Projektgebiete MfMs in Äthiopien.

Eines Tages im MfM-Büro der späten 80er Jahre in der Münchner Nussbaumstraße hatte ich Karlheinz Böhm wohl irgendwie verärgert. Als er von der Mittagspause ins Büro zurückkam, stellte er einen blaugrünen Kaktus auf meinen Schreibtisch und verschwand wortlos in seinem Zimmer. Nach dem Grund dafür habe ich mich all die Jahre nicht getraut zu fragen.
Wie dem auch war, Karlheinz Böhms Ärger verflog, der Kaktus aber blieb. Auf meinem Schreibtisch. Er wurde gepflegt, gehegt, umgetopft, dankte es mir mit schier ungebremstem Wachstum und wurde über die Jahre zu einer großen, stacheligen Kugel. Er überstand jede feuchtfröhliche Feier und jeden Büroumzug, sogar den grauen Baustaub bei allfälligen Renovierungsarbeiten im Büro, ebenso die Reste von literweise kaltem Kaffee.

Als ich mich im Sommer 2017 nach 32 Jahren Tätigkeit bei Menschen für Menschen in den Ruhestand verabschiedete und meine Siebensachen im Sekretariat zusammenpackte, nahm ich auch den Kaktus mit. Fortan zierte er ein sonniges Fensterbrett im Wohnzimmer, es ging ihm gut. So dachte ich zumindest.
Doch irgendwann begann der Kaktus, sich leicht nach links zu neigen, in der Folge mehr und mehr einzuknicken, bis er irgendwann nur noch in sich zusammensackte. Das war‘s. Und das war wohl auch seine stumme Botschaft an mich, unseren Auszug aus dem MfM-Büro hat er mir offenbar nicht verziehen. Nun soll noch einer sagen, dass Pflanzen keine Seele haben.

Edeltraud Hörmann war von Januar 1986 bis Juli 2017 bei der Stiftung Menschen für Menschen als Vorstandssekretärin tätig.

Im Herbst 1982 entdeckte ich in der Süddeutschen Zeitung ein winziges Inserat: „Ehrenamtlich tätige Sekretärin mit Englischkenntnissen gesucht“, ohne genauere Details. Neugierig wie ich war, habe ich dort hingeschrieben, und bekam als prompte Antwort eine Einladung in ein Restaurant in der Innenstadt.
Dort saßen noch mehr neugierige Frauen, die wissen wollten, was das wohl für ein Job sei. Wir wurden von einem Herrn begrüßt und nach einer kurzen Einführungsrunde zu Karlheinz Böhm nach Baldham gebracht. Der war mir als Schauspieler der drei Sissi-Filme mit Romy Schneider bekannt, aber sonst wusste ich von ihm auch nur, dass er der Sohn des Dirigenten Karl Böhm war. Die Geschichte mit der Wette ein Jahr zuvor in der Sendung „Wetten, dass…?“ kannte ich gar nicht.
Die Putzfrau Karlheinz Böhms wollte ich nicht sein
Karlheinz Böhm empfing uns sehr enthusiastisch, erzählte von seiner gestarteten Hilfsaktion und Arbeit in Äthiopien. Mittlerweile gäbe es dafür so viel Schreibarbeit, dass er eine Sekretärin bräuchte – aber erst ab dem nächsten Frühjahr. Bis dahin bräuchte er erstmal nur jemanden, der das Haus nach seiner Abreise nach Äthiopien in Ordnung halten könnte. Als Putzfrau wollte ich definitiv nicht arbeiten – das hatte für mich nichts mit der Ausschreibung als „Sekretärin mit Englischkenntnissen“ zu tun, also lehnte ich dankend ab. Der Fall war für mich erledigt.
Silvester 1982/83 gab es, wie das zum Jahreswechsel ja üblich ist, eine Rückblicks-Sendung im Fernsehen: „Menschen 1982“. In dieser Show interviewte Frank Elstner Karlheinz Böhm zu seinem Hilfsprojekt. Ich hatte zufällig in die Sendung reingeschaltet und war doch sehr beeindruckt. Hinter der Hilfsaktion steckte doch viel mehr, als ich nach dem kurzen Treffen mit Karlheinz Böhm vermutet hatte.
Berge von Post bewältigen? Schon eher!
Im Januar 1983 rief mich eine Dame an, ich wäre doch im Herbst bei Karlheinz Böhm gewesen, ob ich noch an einer Mitarbeit interessiert wäre. Klar, sagte ich ihr, solange ich nicht putzen soll, gerne. Die Aufgabe war eine andere: Ich wurde gebeten, bei mir zuhause Überweisungszettel zu sortieren, denn in den letzten Monaten waren sehr viele Spenden eingegangen. Diese Aufgabe übernahm ich gerne und machte mich nach weiteren Absprachen ans Werk. Zwar hatte ich mit einiges an Arbeit gerechnet, doch die Menge an eingegangenen Überweisungszetteln überstieg dann doch meine Vorstellungen – ich war ziemlich lange beschäftigt.
Im März desselben Jahres rief mich dann Karlheinz Böhm persönlich an und dankte mir für meine Unterstützung bei den Spendenquittungen. Außerdem fragte er an, ob ich denn vielleicht nach Baldham kommen möchte, um ihm auch bei der Bewältigung der eingegangenen Post zu helfen. Klar, ich war neugierig, wollte mehr über diese Hilfsaktion wissen und willigte ein.
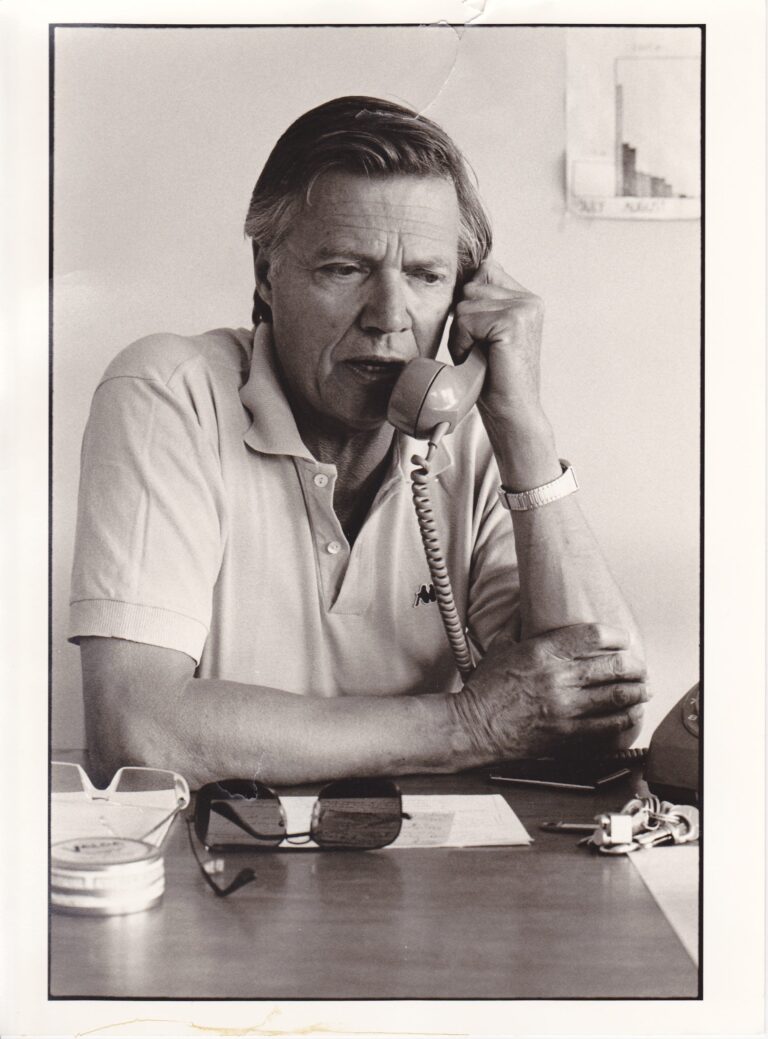
In Baldham angekommen, begrüßte mich Karlheinz Böhm herzlich, dann machten wir uns direkt ans Werk. Das Zimmer, in das Karlheinz Böhm mich führte, stand voll mit mannshoch aufeinander gestapelten Postkästen. Er drückte mir einen Brieföffner in die Hand und bat mich, alle Briefe einfach nach Post für MfM und Privatpost zu sortieren. Das haben wir dann etliche Tage lang gemacht.
Kaiser Franz brät Spiegeleier
Einmal musste ich sehr in mich hineinkichern: Als kurze Pause zwischen all den Briefen briet Karlheinz Böhm für uns zum Mittagessen Spiegeleier und ich stellte mir vor, dass es bestimmt tausende Frauen und Mädchen gäbe, die mich um diese Situation glühend beneideten: „Karlheinz Böhm, besser noch Kaiser Franz Joseph, macht für diese Frau Mittagessen“ – ich fand das nur putzig.
Der Schauspieler interessierte mich nicht, aber mir imponierte, was er mit dem Geld aus der Fernsehsendung auf die Beine gestellt hatte und mit welcher Verve er das Projekt betrieb. Ich fand es spannend, dabei mitzuarbeiten und das Ganze mit aufzubauen. So beschlossen wir, dass ich die Leitung des allerersten wirklichen Büros von MfM übernehmen sollte, das wir in der Kaufinger Straße in München gefunden und in Betrieb genommen hatten.

In den nächsten Monaten war ich jeden Vormittag dort und versuchte zunächst, Ordnung in die bisherige Korrespondenz zu kriegen. Es gab zwei übervolle Ordner, nach dem Prinzip Zufall „geordnet“. Diese Aufgabe mag stumpf klingen, aber mir gefiel sie, so hatte ich die Möglichkeit, alles zu lesen und erfuhr dabei eine ganze Menge darüber, wie aus der Idee der Wette eine richtige Hilfsaktion geworden war.
Barbara Ertl war ab 1982 die erste, damals ehrenamtliche, Sekretärin der heutigen Stiftung Menschen für Menschen. Ab 1983 leitete sie dann das erste wirkliche MfM-Büro in der Kaufinger Straße. Nach ihrem Umzug nach Berlin 1986 war sie weiterhin ehrenamtlich im Arbeitskreis tätig.

Es war einem Zufall geschuldet, dass ich Karlheinz Böhm 1986 in Äthiopien kennenlernte. Es war früher Abend, ich war spontan auf dem Weg zu einem Freund. Als ich an seinem Haus ankam, sah ich einen ausländischen Gast am Abendessentisch, der sich offen mit meinem Freund unterhielt. Mein Freund lud mich ein, mich dazu zu setzen. Natürlich wusste ich nicht, dass dieser Mann Karlheinz Böhm war, und sagte während des ganzen Essens kein Wort, sondern lauschte einfach dem angeregten Gespräch zwischen den beiden.
Der ausländische Gast erzählte meinem Freund von seiner humanitären Tätigkeit, die er vor ein paar Jahren in Äthiopien begonnen hatte. Er erwähnte auch die sozialen Krisen, die er im Osten Äthiopiens beobachtet hatte, die ihn augenscheinlich berührten und ihm keine Ruhe ließen. Früher hielt ich mich aus solchen Themen meist raus, machte lieber einfach mein eigenes Ding, doch an diesem Abend horchte ich auf. Dass ein Fremder so viel mehr über die Lage meines Landes wusste und sich für Verbesserungen einsetzten wollte, überraschte mich nicht nur, es machte mich auch betroffen und verlegen. Am Ende nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte ihn, ob ich ihn auf irgendeine Art und Weise unterstützen kann.
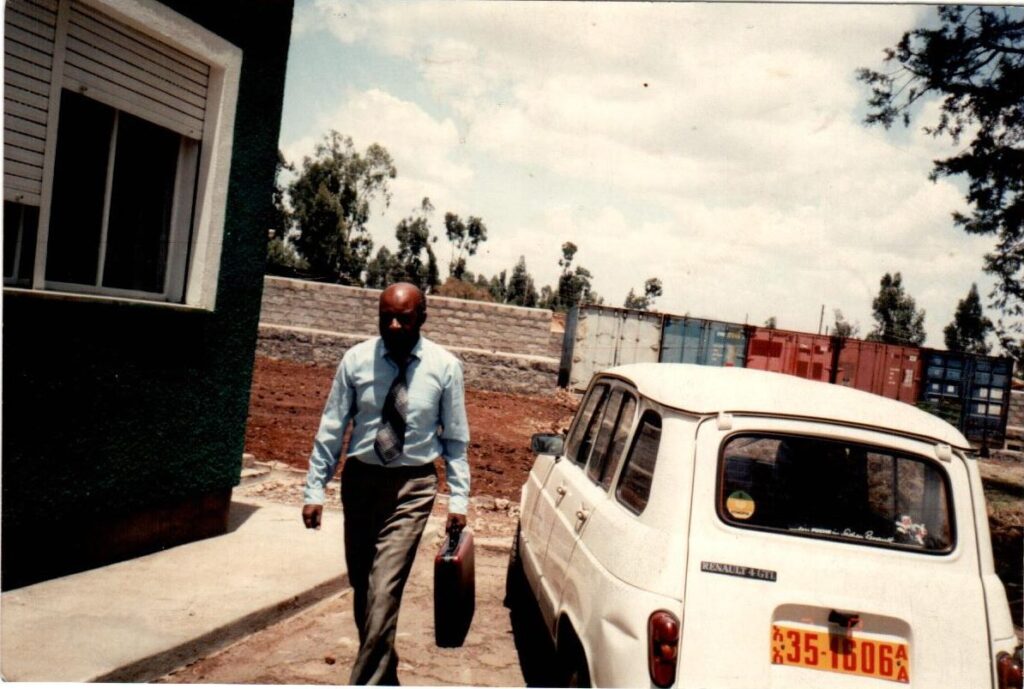
Er reagierte freudig und fragte mich nach meinem Beruf. Ich entgegnete, dass ich viel Erfahrung in Logistik- und Transitfragen habe, daraufhin lud mich Karlheinz Böhm zu einem Kennenlern-Treffen in seinem Büro in Addis Abeba ein. Das Treffen lief gut, und so wurde ich noch im gleichen Jahr der Logistiker von Menschen für Menschen.
Wie ich es empfand, mit Karlheinz Böhm zu arbeiten
Mit Karlheinz Böhm zu arbeiten war für mich immer, wie wieder in die Schule zu gehen. So viel habe ich in den kommenden Jahren über bürokratische Abläufe bei internationalen Warenabwicklungen lernen können, wie man auch bei Routineabläufen motiviert bleibt und andere für die Sache motiviert, und wie wichtig Weitsicht ist. Außerdem, und das geht weit über meine Arbeit als Logistiker hinaus, konnte man von ihm lernen, wie man Menschen liebt und sich um andere kümmert.
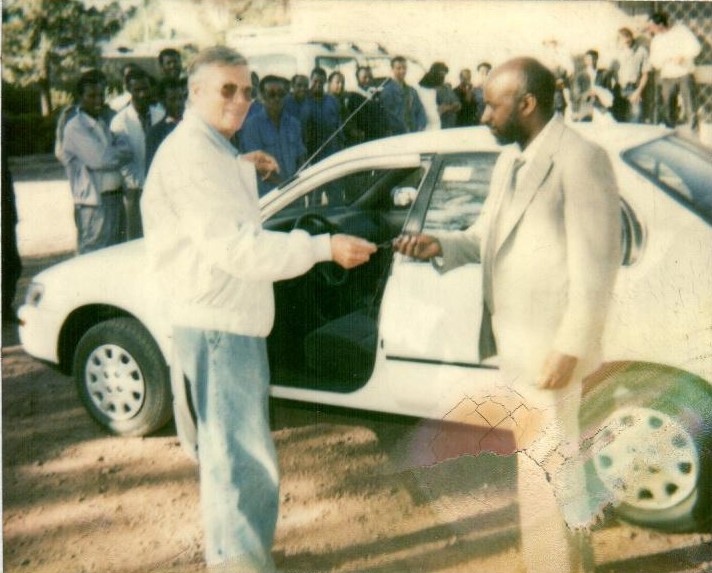
Ich habe die Zusammenarbeit mit Karlheinz Böhm nie als schwer empfunden. Fehler und Misserfolge waren erlaubt, er hat dies immer toleriert – solange man immer ehrlich war. Das war der Schlüssel zur Zusammenarbeit mit ihm und ist bis heute ein grundlegender Arbeitsansatz der Stiftung. Es ist genau diese Ehrlichkeit, die mich über Jahrzehnte lang bei Karlheinz Böhm und der Stiftung Menschen für Menschen hielt.
Ich glaube, dass Ato Karl auf höchster Ebene großen Einfluss hatte
Eines Tages hatte Karl einen Termin mit dem damaligen Premierminister Meles Zenawi. Eine Chance witternd, erinnerte ich Karl daran, das Problem der Besteuerung doch einfach mal anzusprechen. Was dann geschah, konnte ich jedoch kaum fassen: Nach einem längeren Austausch beschloss der Premier, alle Hilfsgüter steuerfrei ins Land zu lassen. Von dieser weitreichenden Entscheidung, welche kurz danach offiziell verlautet wurde, profitierte längst nicht nur die Arbeit von Menschen für Menschen, sondern die aller im Land ansässigen Nichtregierungsorganisationen.
Melaku Taye ist ein MfM-Urgestein – über drei Jahrzehnte lang, um genau zu sein von 1986 bis zu seiner Pensionierung 2018, war er als Logistiker für die Stiftung in Äthiopien tätig. Dabei war sein Beginn bei MfM eher Zufall…

Zuhören. Dieses Credo beherzigte Karlheinz Böhm immer bei seinem Wirken in Äthiopien. Den Menschen dort zuhören, was sie brauchen, wie ihnen geholfen werden kann. Begegnungen auf Augenhöhe. Bei seinen Besuchen der Aktion „Sportler gegen Hunger“ (SgH) in Vechta schlüpfte der frühere Schauspieler meist in eine andere Rolle. Er übernahm den Part des Erzählers, sprach über seine Arbeit, seine Projekte und seine Wut über die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich.
So auch 1992. Beim Warten auf den Auftritt vor Schülerinnen und Schülern in der Aula des Gymnasium Lohne saß Karlheinz Böhm neben Kreissportbund-Geschäftsführer Franz Meyer, der seit dem Start von „Sportler gegen Hunger“ im Jahre 1984 bis zum heutigen Tag die SgH-Spendengelder verwaltet.
Eine Idee entwickelt sich
Sie kamen beim Plaudern auf Meyers Beruf, Kreditberater bei der Commerzbank in Vechta, zu sprechen. Böhm hielt inne und fragte: „Warum nimmt man eigentlich Kredite auf? Die müssen doch sowieso zurückgezahlt werden.“ Als Mann vom Fach brachte es der Banker auf den Punkt: „Weil sie mit Krediten Geld verdienen wollen.“ Ein Satz, der den früheren Schauspieler ins Grübeln kommen ließ.

Die Gedanken kreisten sichtbar durch seinen Kopf und er fragte nach, wie das zu verstehen sei. Franz Meyer erinnert sich noch heute an seine Worte von damals: „Mit einem Kredit kauft man sich Maschinen, um etwas zu produzieren. Mit dem Geld aus dem Verkauf der Produkte zahlt man erste Raten zurück und hat noch Geld über. Und wenn der ganze Kredit abgezahlt ist, geht‘s mit dem Verdienen erst richtig los, dann kann man sich Existenzen aufbauen.“
„Herr Meyer, Sie haben mir sehr geholfen.“
Danach war Karlheinz Böhm ganz in sich versunken, bis zum Beginn des Vortrags kreisten seine Gedanken wohl um Kredite, Geld verdienen und Existenzen aufbauen. Etwa eine Stunde später suchte er gegen Ende seines Vortrages vor den Gymnasiast:innen in der vollbesetzten Aula den Blickkontakt zu den SgH-Vertreter*innen und sagte vom Podium: „Herr Meyer, Sie haben mir sehr geholfen.“

Wenige Jahre später nahm Menschen für Menschen das Kleinkredite-Programm für Frauen in die Projektarbeit auf, bis heute haben rund 30.000 Äthiopierinnen diese Mikrokredite in Anspruch genommen, um ihre Lebenssituation entscheidend zu verbessern und sich Existenzen aufzubauen. Immer, wenn bei SgH-Vertretern und -Vertreterinnen heute die Sprache auf die MfM-Mikrokredite kommt, fällt der Satz „Herr Meyer, Sie haben mir sehr geholfen“. Karlheinz Böhm referierte in Vechta nicht nur über seine Projekte und Arbeit, er hörte auch hier immer zu – wie bei den Menschen in Äthiopien.
Franz-Josef Schlömer ist der Initiator und Gründer der Aktion „Sportler gegen Hunger“ (SgH), welche seit 1984 und bis heute die Stiftung Menschen für Menschen unterstützt. Seit der Gründung bis 2018 war Herr Schlömer Vorsitzender von SgH, seitdem leitet Carsten Boning die Aktion.

Ein Ereignis mit Menschen für Menschen, das ich nie vergessen werde, war die Städtewette 2006 – beziehungsweise deren Entstehung und Vorbereitung. Zu der Zeit war ich Geschäftsführer bei MfM, 2006 feierte unsere Stiftung ihr 25-jähriges Jubiläum. Schon 2005 begannen wir also, darüber nachzudenken, was wir besonderes für diesen Anlass planen wollen.
Von "Wetten, dass...?" zur Städtewette
Die damalige Leitung des Fundraising-Teams, Anne Dreyer, hatte dann eine tolle Idee, die mir auf Anhieb gefiel: Wir könnten doch mit einer Städtewette an unsere Gründungsgeschichte anknüpfen, und dies mit einer Aktion verbinden, die allen Spaß macht, die Aufmerksamkeit erzeugt und die uns von anderen Organisationen abhebt. Und, wie Anne zurecht meinte, keine andere Organisation hat die Möglichkeit, das Wetten als ein Fundraising-Element zu nutzen – dies bleibt uns, mit der Gründungsgeschichte in „Wetten, dass…?“ allein vorbehalten.
Zur Städtewette: Die Idee war, in Deutschland 25 Städte zu finden, deren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister mit Karlheinz Böhm die folgende Wette eingehen: „Mir als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister gelingt es, dass ein Drittel der Bevölkerung dieser Stadt in einem Zeitraum von etwa einem Monat einen Euro an Menschen für Menschen spendet.“ Dabei konnten sich Schulen, Vereine und Unternehmen natürlich ebenso beteiligen wie Privatpersonen. Karlheinz und Almaz Böhm wetteten dagegen, die Wetteinsätze überlegten sich die Städte selbst.
Ich muss zugeben, dass wir mit einer solchen Aktion keine Erfahrungen hatten. Uns war aber bewusst, dass die Städtewette nur funktionieren würde, wenn uns ein bundesweiter Startschuss mit großer Aufmerksamkeit gelingt, von heute auf morgen müssten ganz viele Menschen von der Städtewette hören. In einem kleineren Rahmen würde die Aktion sofort untergehen.
2006 war, obwohl das Internet und soziale Medien natürlich täglich an Bedeutung gewannen, das Fernsehen immer noch ein Hauptmedium, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Unsere Schlussfolgerung: Ein großer Fernsehauftritt muss her! Monatelang liefen wir von einem Sender zum anderen, fragten an, bekamen Absagen, nirgendwo ergab sich eine passende Möglichkeit. Nach einiger Zeit hatten wir die Idee, salopp gesagt, schon wieder mehr oder weniger in die Tonne gehauen und fingen an, uns andere, leichter durchzuführende Ideen zu überlegen. Die Umsetzung der großen Städtewette schien einfach nicht machbar.
Gottschalks Anruf veränderte alles
Doch, wie es der Zufall will, rief an einem Freitagnachmittag dann die Redaktion von Thomas Gottschalk, der inzwischen die Sendung „Wetten, dass…?“ moderierte, bei mir an. Sie erzählten mir, dass in der „Wetten, dass…?“-Sendung in 15 Tagen ein Platz frei wäre. Sie fragten, ob sich Karlheinz Böhm wohl vorstellen könnte, in die Sendung zu kommen.

Das darf ja wohl nicht wahr sein – ich konnte es kaum glauben! Nach Monaten des Suchens kam nun diese Möglichkeit um die Ecke, und wir hatten, da wir den Plan ja schon wieder gekippt hatten, nichts in der Tasche außer der Idee, kein Konzept, keine Grafiken, rein gar nichts. Es war Freitagnachmittag – die Sendung sollte 15 Tage später stattfinden – und wäre der ideale Startschuss unserer Städtewette. Ich sagte der Redaktion, dass ich mich am Montag zurückmelden würde.
Wer nicht wagt, ...
Das ganze Wochenende grübelte ich zuhause über den Anruf. Zwischenzeitlich dachte ich, wir sollten einfach Karlheinz Böhm in der Sendung auftreten lassen, aber die Städtewette vergessen, doch irgendwie ließ mir die sich spontan aufgetane Möglichkeit keine Ruhe. Das Team brannte für diese Idee, hatte dort einen genialen Einfall entwickelt – sollten wir uns diese Möglichkeit entgehen lassen? Sonntagabend beschloss ich dann, dass wir es einfach probieren würden, auch, wenn wir möglicherweise dabei auf die Nase fallen.
So rief ich direkt am Montagmorgen das Team zusammen und erzählte ihnen von dem Anruf der „Wetten, dass…?“-Redaktion. „Heute starten wir“, sagte ich ihnen, „und in zehn Arbeitstagen muss alles stehen.“ Die Ärmsten haben mich erst für verrückt erklärt – wir hatten kein Material, keine teilnehmende Stadt, wir hatten nichts außer einer großartigen Idee.
Von der Idee zur Wette
Die darauffolgenden Tage bis zu Karlheinz Böhms Auftritt bei „Wetten, dass…?“ waren wir alle dauerhaft auf den Beinen. Ich fuhr nur durch die Städte Deutschlands, sprach in Rathäusern mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, im Büro arbeitete das Team an den Materialien, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, an allen Teilen der Umsetzung. Immer, wenn ich nach langen Tagen des Reisens abends wieder im Münchner Büro ankam, waren alle aus dem Team immer noch da und schufteten wie die Verrückten. Teilweise musste ich die Leute nachts nach Hause schicken, sie dazu überreden, Kraft zu tanken, damit es am nächsten Morgen weitergehen konnte.
Es war eine unfassbar bewegende Zeit, die mich sehr berührt hat. Das Team hat einen unglaublichen Spirit und Willen an den Tag gelegt, um die Aktion umzusetzen – mit allem, was dazugehört. Am Ende waren 21 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, der Auftritt Karlheinz Böhms bei Thomas Gottschalk und die anschließenden Städtewetten waren ein großartiger Erfolg.
Mich macht es bis heute stolz, wie unser ja doch recht kleines MfM-Team in diesen Wochen zusammengearbeitet hat, mit wie viel Enthusiasmus und Durchhaltevermögen alle bei der Sache waren, und wie viel wir letztendlich auf die Beine stellen konnten – und das in weniger als zwei Wochen!

Schon 1984 begann Axel Haasis als Schüler, ehrenamtlich für Menschen für Menschen zu arbeiten und setzte dieses Engagement auch während seines Studiums fort. Von 1993-2013 war er hauptamtlich für die Stiftung tätig, erst als Leiter der Fundraising-Abteilung (bis 2002), dann als Geschäftsführer.

Ich war noch ein junges Mädchen, als ich Karlheinz Böhm als Kaiser Franz in den Sissi-Filmen sah. Oft träumte ich danach, einmal so ein schönes Kleid wie das von Sissi – gespielt von Romy Schneider – anzuhaben, und dann mit Kaiser Franz über das Parkett zu rauschen, mich in seinen Armen wiegend einen Wiener Walzer zu tanzen. Hach, was für Träume man als Jugendliche doch hat!
Von Schul-Bekanntschaft zu guten Freunden
1993 zogen mein Ehemann Loukas und ich dann beruflich nach Addis Abeba, ich fing eine Stelle als Konrektorin an der Deutschen Botschaftsschule mit integriertem Kindergarten an. Auf dieser Schule waren auch, was mir zu dem Zeitpunkt erst gar nicht bewusst war, Karlheinz und Almaz Böhms Kinder Nici und später auch Aida. So stand plötzlich des Öfteren Karlheinz Böhm vor mir, als er seine Kinder abholte.
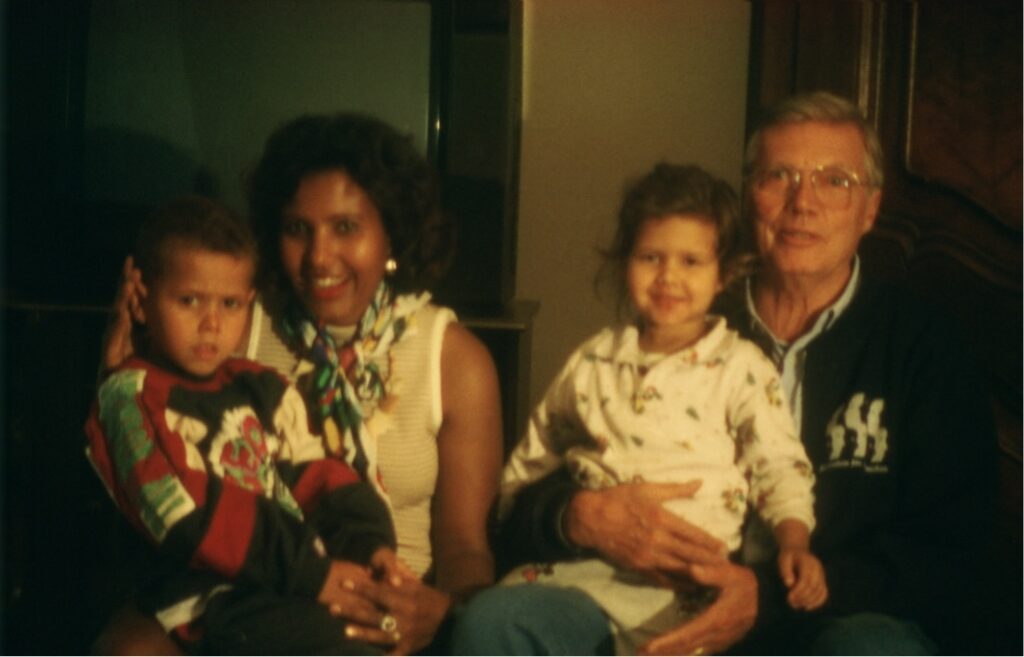
Aus ersten losen Begegnungen wurden schnell engere Gespräche, Loukas fing auf Karls Anfrage bald an, Almaz Deutschunterricht zu geben. Es entstand eine enge Freundschaft, wir besuchten uns viel. Bei meinem ersten Besuch in dem Haus der Böhms war ich ganz neugierig: „Karlheinz Böhm wohnt sicher in einem halben Schloss“, dachte ich anfangs. Weit gefehlt. Das Haus war einfach und gemütlich. Ich glaube, selbst unser Haus war größer.
Ein Kindheitstraum wird wahr
An einem der gemeinsamen Abende bei uns daheim erzählte ich Karlheinz Böhm über einem Glas Wein lachend von meinem Jungmädchentraum, und dass ich mir damals nie hätte träumen lassen, nun wirklich mit „Kaiser Franz“ befreundet am Essenstisch in Addis Abeba zu sitzen. „Na, dann leg doch mal einen Walzer auf. Wir können das ja nun nachholen“, überraschte mich Karl und schon schwebte ich mit ihm ein paar Minuten über den Linoleumboden unseres Wohnzimmers. Zwar nicht in Ballkleid, sondern in Jeans, aber das war nun wirklich egal.
So erfüllte mir Karl meinen Kindheitstraum und schenkte mir viele weitere Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Auch, nachdem Loukas und ich wieder nach Deutschland zurückkehrten, blieb die Freundschaft zu Karl und Almaz bestehen, Karlheinz war auch bei uns in Osterode zu Besuch, wir auch in dem Haus der beiden in Grödig. Obwohl wir uns zwischendurch oft länger nicht gesehen hatten, war die alte Vertrautheit und Verbundenheit immer sofort wieder da.

Inzwischen waren wir auch ehrenamtlich für die Stiftung aktiv, bei den Veranstaltungen hat Karl, voller Begeisterung für seine Arbeit und mit ungebremster Motivation, die Menschen immer sofort mitreißen können. Ich hoffe, dass wir durch unser Engagement diese Motivation und Begeisterung noch ganz lang weitertragen können.
Brigitte Maniatis und ihr Ehemann Loukas zogen 1993 nach Addis Abeba, wo sie eine Stelle als Konrektorin an der Deutschen Botschaftsschule begann. Da Karlheinz Böhms Kinder an dieser Schule waren, entstand aus ersten Begegnungen bald eine enge Freundschaft, welche auch nach der Rückkehr von Brigitte und Loukas Maniatis nach Deutschland 1999 bestehen blieb. Die beiden engagieren sich bis heute auch ehrenamtlich für die Stiftung.

Die Geschichte meiner persönlichen Verbundenheit mit der Stiftung Menschen für Menschen reicht zurück in das Jahr 1831. Sozusagen. In jenem Jahr nämlich wurde in Duisburg das Steinbart-Gymnasium gegründet, das deshalb im Jahr 1981 – ich besuchte damals dort die 8. Klasse – stolz auf seine 150-jährige Geschichte zurückblickte. Die Schulgemeinde feierte dieses Jubiläum am Freitag, dem 15. Mai 1981, mit einem großen Schulfest. Meine Klasse kümmerte sich um das sogenannte „leibliche Wohl“ der Besucherinnen und Besucher und schloss den Tag mit einem Überschuss von 750 D-Mark ab. Wir wussten noch nicht so recht, was wir mit dem Gewinn machen sollten, er sollte irgendeinem wohltätigen Zweck zu Gute kommen.
Die Frage, welcher Zweck das konkret sein würde, wurde schon am nächsten Tag beantwortet. Am 16. Mai 1981 wurde im ZDF die Sendung „Wetten, dass…?“ ausgestrahlt, in der Karlheinz Böhm zu Gast war. Was dort geschah, ist bekannt – am Montag beschloss meine Klasse, unseren Gewinn Karlheinz Böhm zur Verfügung stellen.
Nicht nur spenden, raus aus der Komfortzone!
Die Spende allein reichte uns aber nicht. Ich hatte die Wette von Karlheinz Böhm immer so verstanden, dass es ihm nicht wichtig war, dass die Zuschauer ein großes finanzielles Opfer bringen. Im Gegenteil: Eine Mark konnte jede und jeder erübrigen. Ihm ging es darum, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre, wie man heute formulieren würde, „Komfortzone“ verlassen und selbst etwas tun – Karlheinz Böhm sprach von der „Überwindung des eigenen faulen Schweinehundes in uns selber“.

Auch für die Einzahlung von nur einer Mark musste man damals zur Bank oder zum Postamt gehen, das Onlinebanking war noch nicht erfunden. Unsere Einzelspende von 750 Mark entsprach somit nicht der ursprünglichen Idee und war so gesehen natürlich wettbewerbsverzerrend. Aber auch wir Schülerinnen und Schüler überwanden den „faulen Schweinehund“, nahmen mit Karlheinz Böhm Kontakt auf (der dann auch kurze Zeit später unsere Schule besuchte) und boten ihm unsere aktive Unterstützung an. Hieraus entstand eine Schüleraktion, die in den kommenden fünf Jahren bis zu unserem Abitur 1986 eine Vielzahl von Aktivitäten zum Fundraising entwickelte.
10.000 Briefe, von Hand geschrieben, kuvertiert und ausgetragen
Die nach meiner Erinnerung aufwändigste Aktivität jener Zeit war ein Briefversand: Mit über 10.000 Briefen, die wir über mehrere Wochen im gesamten Stadtgebiet von Duisburg selbst ausgetragen haben, haben wir im Frühjahr und Sommer 1983 unsere Schüleraktion und insbesondere die Stiftung Menschen für Menschen und deren erstes Hilfsprojekt (Erer-Tal im Südosten Äthiopiens) in unserer Region bekannt gemacht. Allein die Produktion der Briefe war für uns Schülerinnen und Schüler (wir waren mittlerweile 15 oder 16 Jahre alt) eine logistische Herausforderung ersten Ranges.
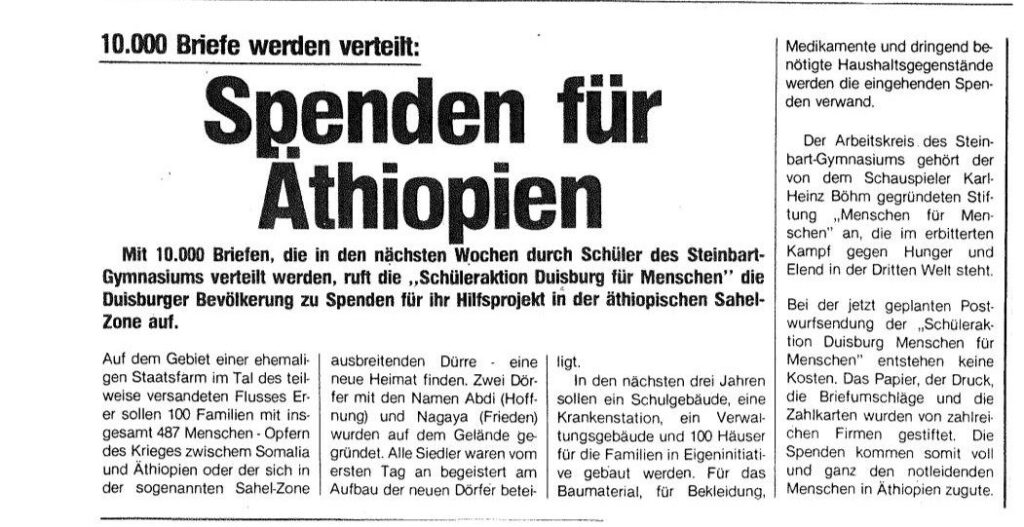
Wir hatten alles, was wir dazu benötigten, von Duisburger Unternehmen gespendet bekommen: Das Briefpapier stellte eine Werbeagentur für uns her, die Briefumschläge stiftete eine ortsansässige Brauerei und die Überweisungsvordrucke, die den Adressaten das Spenden erleichtern sollte, lieferte die Stadtsparkasse Duisburg kostenfrei zu. Was ich damals gelernt habe: Wer fragt, bekommt Antworten; lass Dich nicht abwimmeln; und wenn Dich vorn jemand wegschickt, versuch’s noch einmal durch die Hintertür. Das hat eigentlich immer funktioniert, wir wurden nie enttäuscht.
Da saßen wir also wochenlang nachmittags nach dem Unterricht in einem Raum in der Schule, den uns der Schulleiter zur Verfügung gestellt hatte, und schrieben, falzten und kuvertierten über 10.000 Briefe, die wir an anderen Tagen selbst austrugen, um Porto zu sparen. Irgendwann wurde die schreibende Presse auf unsere Aktion aufmerksam und berichtete sehr wohlwollend darüber, was später sogar das Interesse des ZDF weckte. Ein Fernsehteam begleitete uns einige Tage und berichtete in einer 45-minütigen Reportage zur besten Sendezeit über unsere Gruppe und ihre Initiativen. Das alles machte unsere Aktion auch über die Grenzen unserer Stadt hinaus bekannt und sorgte insbesondere dafür, dass unsere Briefe wahrgenommen wurden und nicht ungelesen im Müll landeten. Ich erinnere mich an den Anruf einer älteren Dame, die sogar darum bat, ebenfalls einen solchen Brief zu bekommen, sie habe das im Fernsehen gesehen. Wir erfüllten ihren Wunsch und sie unterstützte die Stiftung über viele Jahre jeden Monat sehr großzügig mit einem Dauerauftrag.
Die Steine kamen ins Rollen - viele Aktionen folgten
Unvergessen ist auch der Anruf eines Insolvenzverwalters Ende November 1984, der in einem Verfahren 30.000 „klingende Weihnachtskarten“ nicht verwerten konnte, weil es sich um Fehldrucke handelte. Die könnten wir haben. Wir hatten aber nur einen Advent Zeit, um sie zu Geld zu machen, im nächsten Jahr wären die kleinen Knopfzellen leer gewesen. Und so haben wir sämtliche Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen mit diesen (aus Sicht des heute Erwachsenen absolut geschmacklosen) Weihnachtskarten regelrecht überschwemmt. Jeder Karte haben wir ein Informationsblatt über die Stiftung beigelegt, abermals ermöglicht durch die großzügige Unterstützung eines Druckereibetriebes. Auf diese Weise haben wir nicht nur den Kaufpreis erhalten, sondern auch gleich noch für die Arbeit der Stiftung geworben. Was waren wir erleichtert, als Weihnachten vorbei war!

All diese Aktivitäten und Gemeinschaftserlebnisse haben uns geprägt und sind uns allen in bleibender Erinnerung geblieben. Aber wie das so ist: Nach fünf Jahren löste sich die Schüleraktion 1986 zwangsläufig auf, nachdem wir alle das Abitur bestanden hatten und wir uns in alle Himmelsrichtungen zerstreuten. Die Bilanz: Aus den 750,00 Mark, die wir beim Jubiläums-Schulfest des Steinbart-Gymnasiums 1981 erzielt hatten, waren bis zum Abitur insgesamt mehr als 580.000 Mark geworden, die die Schüleraktion an die Stiftung Menschen für Menschen überwiesen hat. Auch wenn unsere Schüleraktion als solche nicht mehr existiert, ist die Verbundenheit zur Stiftung in den 40 Jahren seit ihrer Gründung stets erhalten geblieben, auch und gerade für mich persönlich.

Stephan Altenburg unterstützt die Stiftung seit der ersten Stunde – um genau zu sein, sogar schon seit dem Tag vor Karlheinz Böhms Wette. Als Schüler startete er eine große Spendenaktion und war dann lange ehrenamtlich der Regionale Ansprechpartner von Menschen für Menschen in Nordrhein-Westfalen, bevor er 1989 zum Jurastudium nach München ging und im Anschluss eine erfolgreiche Anwaltskanzlei aufbaute.

Rein zufällig las ich Mitte der 1980er das erste „Nagaya“ Buch von Karlheinz Böhm. Nachdem ich dann noch merkte, dass das Büro von Menschen für Menschen sehr nahe meiner Wohnung in München lag, war mein Entschluss gefasst: Ich wollte mitmachen. So begann ich 1985 meine ehrenamtliche Tätigkeit für Menschen für Menschen. Zu dem Zeitpunkt gab es neben Karlheinz Böhm selbst nur eine Festangestellte, Renate Eickemayer, die das Büro leitete, alle anderen waren ehrenamtlich tätig.
Wie lief das, in nicht digitalen Zeiten?
Meine Hauptaufgabe, sowohl in meinen ersten ehrenamtlichen Jahren, als auch danach als Festangestellte, war die Bearbeitung der eingehenden Post und die Überweisungsscheine. Heutzutage kann man sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, aber in den Anfangsjahren von MfM gab es noch keine elektronischen Überweisungen. Wir bekamen die Überweisungsscheine von den Banken oder den Privatleuten postalisch an unser Büro gesendet. So standen bei uns in dem einen Zimmer, in dem alle arbeiteten, überall Kisten mit Briefen. Das Zimmer war so voll, dass die Buchhaltung in der ersten Zeit als ihren „Tisch“ die Fensterbank benutzte.
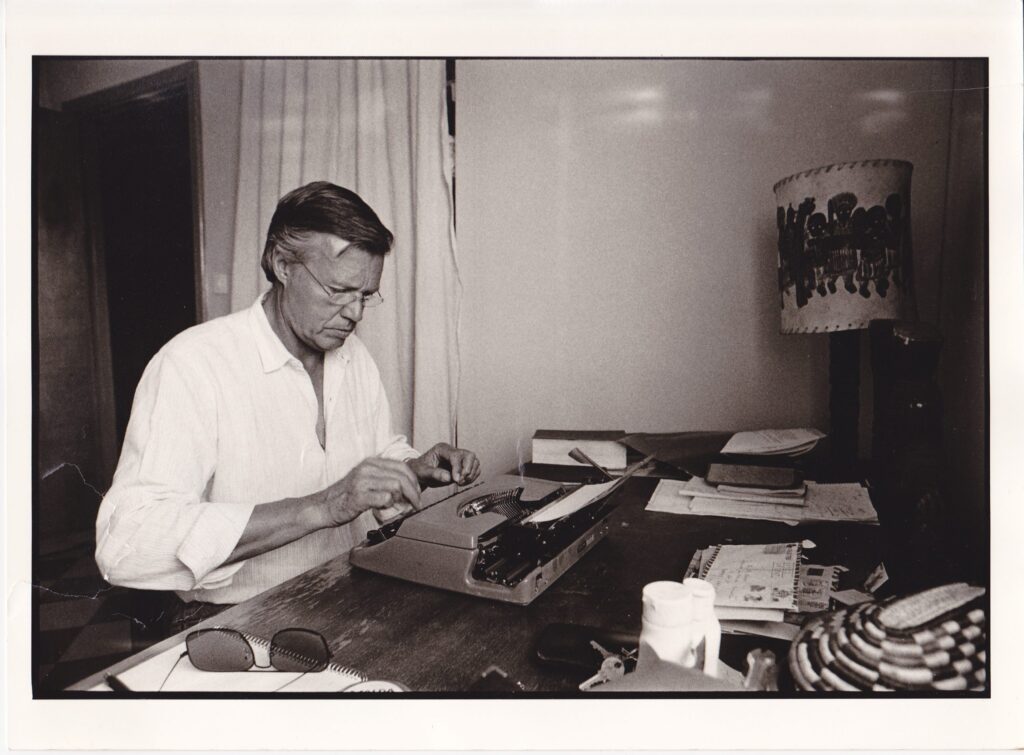
Ganz am Anfang gab es nur bei Spenden mit höheren Summen einen Dankesbrief dazu, sonst wurde einfach eine Quittung versendet. Da wir am Anfang noch nicht mal einen Schreibautomaten im Büro hatten, tippte ich diese Briefe nämlich immer zuhause auf meiner privaten Schreibmaschine – hätten wir dies für jede Spende machen müssen, wären wir einfach nicht fertig geworden. Doch nachdem ich dann 1988 festangestellt wurde, bekamen wir einen IBM Schreibautomaten und konnten die Post und Überweisungen dadurch schneller bearbeiten – ein großes Highlight!
Noch etwas, was in den heutigen Zeiten unvorstellbar erscheint, war unsere Adressrecherche. Denn nicht immer konnte man den Namen und die Adresse der Spenderinnen und Spender auf den Überweisungsscheinen gut lesen. In einem Kämmerchen hatten wir also die großen, dicken Telefonbücher Deutschlands und haben uns so anhand der lesbaren Elementen an die richtige Person herangetastet.
Meine verrücktesten Spenden-Erinnerungen
In meinen vielen Jahren in der Spendenbetreuung habe ich natürlich die unterschiedlichsten Spenden und Personen dahinter erlebt, ein paar sind mir jedoch in besonderer Erinnerung geblieben.
Anfang der 90er sendete eine Person zum Beispiel jeden Monat 18.000 DM, eine riesige Summe, wollte jedoch eindeutig nicht erkannt werden. Jedes Mal kam der Überweisungsschein unter einem anderen Namen bei uns an, Heinz Bender aus Düsseldorf, Egon Müller aus Dortmund, nie war eine Kontonummer oder Adresse dabei, die Handschrift war aber eindeutig identisch. Es blieb uns für immer ein Rätsel, nach ein bis zwei Jahren hörten die Spenden schließlich wieder auf.

Auch gab es mal eine Dame, mit der ich mehrere Male telefonierte und die dann 20.000 DM spendete. Kurz darauf verstarb sie. Mir wurde klar, dass sie ihre gesamten Ersparnisse der Stiftung hatte zu Gute kommen lassen wollen. Kurz darauf riefen ihre Kinder bei uns an, forderten das Geld zurück und behaupteten, ihre Mama wäre dement gewesen. Den Eindruck hatte ich in unseren langen Telefonaten nie gehabt. Den rechtlichen Grundlagen folgend sagte ich den Kindern, dass ich ein ärztliches Attest bräuchte, das nachweist, dass ihre Mutter nicht mehr voll zurechnungsfähig gewesen war. Darauf bekam ich nur die schnippische Antwort: „Pah, dann behalten sie das Geld halt!“
Bis heute ein Rätsel: eine Zwiebacktüte voll Geld
Einmal, dies muss auch in den ersten Jahren gewesen sein, fanden wir am Morgen einfach eine Zwiebacktüte vor unserer Bürotür, jemand musste sie dort hingelegt haben. Die Tüte stank bestialisch, doch als wir sie öffneten, befanden sich 20.000 D-Mark darin, voller Krümel, aber echtes Geld. Zwar wurden bei uns immer mal anonyme Barspenden eingeschickt, in einer stinkenden und verkrümelten Tüte habe ich diese aber normalerweise nicht entgegengenommen.
Eine letzte Spenden-Erinnerung, die ich gerne teilen möchte, war 2001, kurz vor der Umstellung von D-Mark auf Euro. Zu dem Zeitpunkt nahmen wir mit allen Spenderinnen und Spendern Kontakt auf, denn die bisherigen geraden Dauerspendenbeträge wurden ja nun zu sehr krummen Beträgen. So fragten wir alle, ob sie diesen krummen Betrag weiterhin spenden oder auf- oder abrunden wollten.
Eine Frau aus Norddeutschland, die monatlich 100 DM spendete, hatte auf unseren Brief nicht reagiert. Schlussendlich rief ich bei ihr an. „Ja, dann machen sie doch 100 Euro daraus!“, meinte sie am Telefon. Als ich sie darauf aufmerksam machte, dass dies fast das Doppelte der bisherigen Spende wäre, war ihre Antwort nur: „Das macht doch nichts, ich wohne inzwischen im Altenheim und kriege hier dreimal am Tag kostenlos Essen! Da wird das Geld in Äthiopien doch bessere Verwendung finden.“
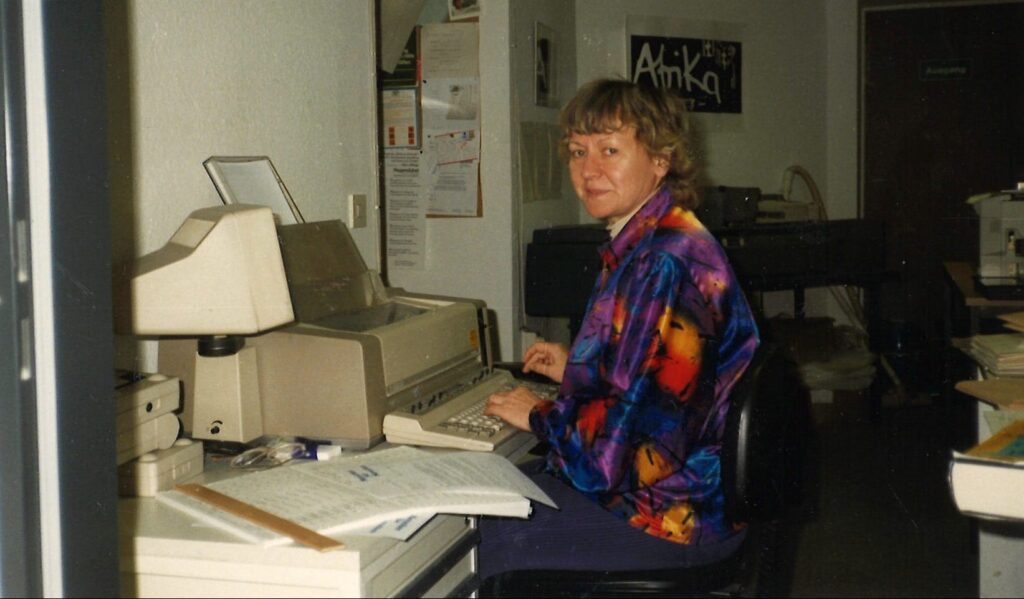
All diese, und noch so viele weitere Erlebnisse, zeigen die vielen unterschiedlichen Menschen hinter Menschen für Menschen, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, das Fundament der Stiftung. Es macht mich stolz, dass ich so viele Jahre lang dieses Fundament pflegen und hegen durfte – einer der vielen Gründe, warum ich bis heute aktiv für die Stiftung tätig bin.
Nachdem sie das Buch „Nagaya“ von Karlheinz Böhm gelesen hatte, beschloss Irmgard Lehmann, sich für die gute Sache zu engagieren. An ihrem 49. Geburtstag, im Jahre 1985, betrat sie zum ersten Mal das MfM-Büro in der Neuhauser Straße. Für die nächsten drei Jahre arbeitete sie ehrenamtlich in der Spendenbetreuung, danach als Festangestellte bis 1996. Von da an war sie auf Teilzeitbasis weiterhin tätig, bis heute unterstützt sie das MfM-Team im Bereich Fundraising & Kommunikation einen Tag die Woche – und bringt auch mit ihren 85 Jahren jede Woche wieder frischen Schwung ins Büro!

Meine Frau und ich haben Karlheinz Böhm 2006 in Addis Abeba kennengelernt. Ich war seit Februar dieses Jahres deutscher Botschafter und erhielt eines Tages einen Anruf, dass Karlheinz Böhm in Addis ist und er uns gerne kennenlernen möchte. Er war schon zu Zeiten meiner Vorgängerin ein gern gesehener Gast in der Deutschen Botschaftsresidenz und wir freuten uns über diese Nachricht. Meine Frau konnte so auch den Schwarm ihrer Jugend persönlich treffen.
Ein Termin wurde gefunden und wir standen mit klopfendem Herzen an der Tür, als Karlheinz von der Pforte angekündigt wurde. Es war Sympathie auf den ersten Blick, wir verstanden uns sofort, die Gespräche wollten nicht enden. Er erzählte lebhaft von seiner Wette – wie alles begann und von seinen Projekten, den früheren Aufenthalten in der Botschaftsresidenz und den Begegnungen mit unseren Vorgängerinnen und Vorgängern.
Spontan beschlossen wir zusammen mit dem österreichischen und dem Schweizer Botschafter sowie Menschen für Menschen, Karlheinz Böhms 80. Geburtstag mit Freundinnen und Freunden und Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern bei uns in der Botschaftsresidenz zu feiern.
Gemeinsame Reisen in die Projektgebiete
Es folgten noch viele weitere Treffen mit Karlheinz und seiner Frau Almaz, Gespräche über bereits geförderte und geplante Projekte und Reisen mit ihm, Almaz und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Menschen für Menschen. Dabei konnten wir die tiefe Verehrung der äthiopischen Menschen für „Ato Karl“ auf allen Reisen spüren und erleben. Geschenke wurden in das Auto gereicht, Frauen trällerten am Straßenrand, Reiter auf geschmückten Pferden kamen uns entgegen, sobald der Wagen von Menschen für Menschen sich dem Dorf näherte.

Wir besuchten die von Menschen für Menschen mit Spendengeldern errichteten Schulen, Krankenhäuser, Brunnen, Brücken, Straßen etc. und könnten zu jedem Projekt noch viel erzählen.

Bei unserem ersten Treffen erzählte Karlheinz, wie die Bauern sich bei ihm über die vielen Steine auf dem Feld beklagten. Die Unterhaltung fand mit „Händen und Füßen“ statt, Karlheinz sprach kein Amharisch, die Bauern kein Deutsch oder Englisch. Aber Karlheinz verstand, stand auf, hob einen Stein hoch und brachte ihn an den Rand des Feldes. Dies wiederholte er einige Male. Dann verstanden es auch die Bauern, machten es ihm nach, es entstand eine Mauer, und nach einer Woche war das Feld frei und konnte bewirtschaftet werden.
Unsere Geburtstagsfeier für Karlheinz
Dann kam Karlheinz 80. Geburtstag, der von den drei Botschaften und Menschen für Menschen mit großem Einsatz organisiert worden war. Etwa 400 Personen waren eingeladen, Ehrengast war natürlich Karlheinz, aber auch der deutsche Staatspräsident Horst Köhler war anwesend. Es wurden Reden gehalten und Spezialitäten aus Österreich, Schweiz und Deutschland gereicht. Es war ein gelungenes Fest.


Am Ende der Feier, als die Gäste sich verabschiedeten, kam eine Dame auf mich zu, strahlte mich an und sagte „Herr Böhm, Sie sehen aber nicht wie 80 aus“. Bis heute weiß ich nicht, wer diese Dame war und wer sie eingeladen hatte. Denn sie kannte Karlheinz offensichtlich nicht, sonst hätte sie mich (damals 62 Jahre alt) nicht mit Karlheinz verwechseln können!

Dr. Claas Dieter Knoop ist pensionierter Diplomat und seit 2018 Teil des Kuratoriums der Stiftung Menschen für Menschen. Er war von 2006 bis 2010 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Äthiopien, und lernte während dieser Zeit auch Karlheinz Böhm kennen.

Im Frühjahr 2008 warteten Eckart Witzigmann und ich im Restaurant „Blauer Bock“ in München auf Almaz und Karlheinz Böhm. In telefonischen und persönlichen Gesprächen mit Menschen für Menschen hatten wir unsere Idee, gegen Karlheinz Böhm zu wetten, schon besprochen. Doch heute war der Tag, an dem wir ihm unser Projekt vorstellen wollten. Almaz und Karlheinz verspäteten sich. Der vorherige Termin hatte sich verschoben, der Verkehr war kollabiert und durch den Umbau der Schrannenhalle gab es keine Parkplätze am Viktualienmarkt, wo der „Blauer Bock“ ansässig ist.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung versuchten, uns die Zeit zu verkürzen, indem sie Geschichten und Anekdoten aus den letzten 20 Jahren mit Karlheinz erzählten. Viele dieser Geschichten handelten von dem Zorn, mit dem er gegen die Ungerechtigkeit auf diesem Planeten kämpfte, und mit jeder Geschichte erschien er mir noch zorniger, als in der Geschichte zuvor. Mittlerweile erwartete ich, dass ein riesengroßer Karlheinz Böhm gleich mit zornrotem Kopf das Lokal stürmt und erst einmal die Möbel graderückt und seinem Unmut Luft macht. Ich war schon richtig nervös, als endlich die Meldung kam, dass er jetzt da wäre.
Von wegen zornig - fast eher schüchtern
Dann steckte ein eher schüchterner Karlheinz Böhm den Kopf durch die Tür und fragte, ob er hier richtig sei. Nachdem er eintrat, bemerkte ich, dass Karlheinz zwar groß war, aber eher mittelgroß. Er war auch nicht zornig, sondern eher freundlich. Ich erwartete auch eine gewisse Strenge und hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass wir die Wartezeit mit einer Flasche Wein überbrückt hatten.
Als er die Flasche sah, lobte er unseren guten Geschmack und schloss sich trotz der frühen Mittagsstunde an. Geplant war ein kurzer Lunch von etwa einer Stunde. Durch die Verspätung war diese Stunde längst vorbei. Der Nachfolgetermin wäre schon dran gewesen. Karlheinz telefonierte und verschob einige Termine und sagte, dass er sich etwas Luft verschafft habe.
Das Gefühl, sich zu kennen
Wir setzten uns an einen Tisch, und kurz darauf fing der Zauber an. Schon kurz nach Gesprächsbeginn fanden Eckart und Karlheinz heraus, dass sie aus demselben Dorf stammen und in dieselbe Schule gegangen und zum Teil dieselben Lehrer hatten. Almaz stellte sich als versierte Hobbyköchin mit einem unglaublichen Fachwissen heraus, was sie in den folgenden Jahren immer wieder unter Beweis stellte.

Es dauerte nur Minuten, um festzustellen, dass wir keine Fremde aus fremden Welten waren, die zusammengeführt werden müssen, sondern Brüder und Schwester im Geiste. Ein Gefühl, das uns immer begleitete und Momente der größten Freude, aber auch der tiefsten Trauer miteinander teilen ließ. Wir durften oft und viel zusammen lachen, aber auch den Tränen, ohne einen bitteren Beigeschmack, freien Lauf lassen.
Wettstart unter Gastronomen
Natürlich war die Wette schnell eine beschlossene Sache. Wir verabredeten uns für den 15. September 2008 auf dem Süllberg in Hamburg, um dort die Wette feierlich und öffentlich abzuschließen. Unsere Wette lautete: „Eckart Witzigmann und ich wetten, dass wir es schaffen innerhalb von nur 100 Tagen unter Zuhilfenahme der Gastronomen in Deutschland, eine Spendensumme von 250.000 Euro zu generieren, um damit eine Schule aus Stein und Stahl und Glas für 1.000 Kinder in Äthiopien zu bauen.“

Almaz und Karlheinz Böhm wetteten dagegen. Um es kurz zu machen: Die Böhms verloren diese Wette, und sie verloren sie gerne. Ihren Wetteinsatz, für alle unterstützenden Gastronomen ein Menü zu kochen, lieferten sie einige Wochen später mit Bravour auf einer Charity-Veranstaltung in Frankfurt ab, wo Almaz zum ersten Mal ihre große gastronomische Klasse unter Beweis stellen konnte.
Ralf Bos ist Unternehmer und Mitglied im Kuratorium der Stiftung Menschen für Menschen. Der Delikatessengroßhändler und Geschäftsführer von BOS FOOD aus Meerbusch hat 2008 die Initiative „Spitzenköche für Afrika“ mit seinen Partnerinnen und Partnern ins Leben gerufen und unterstützt seitdem Bildungsprojekte in Äthiopien.
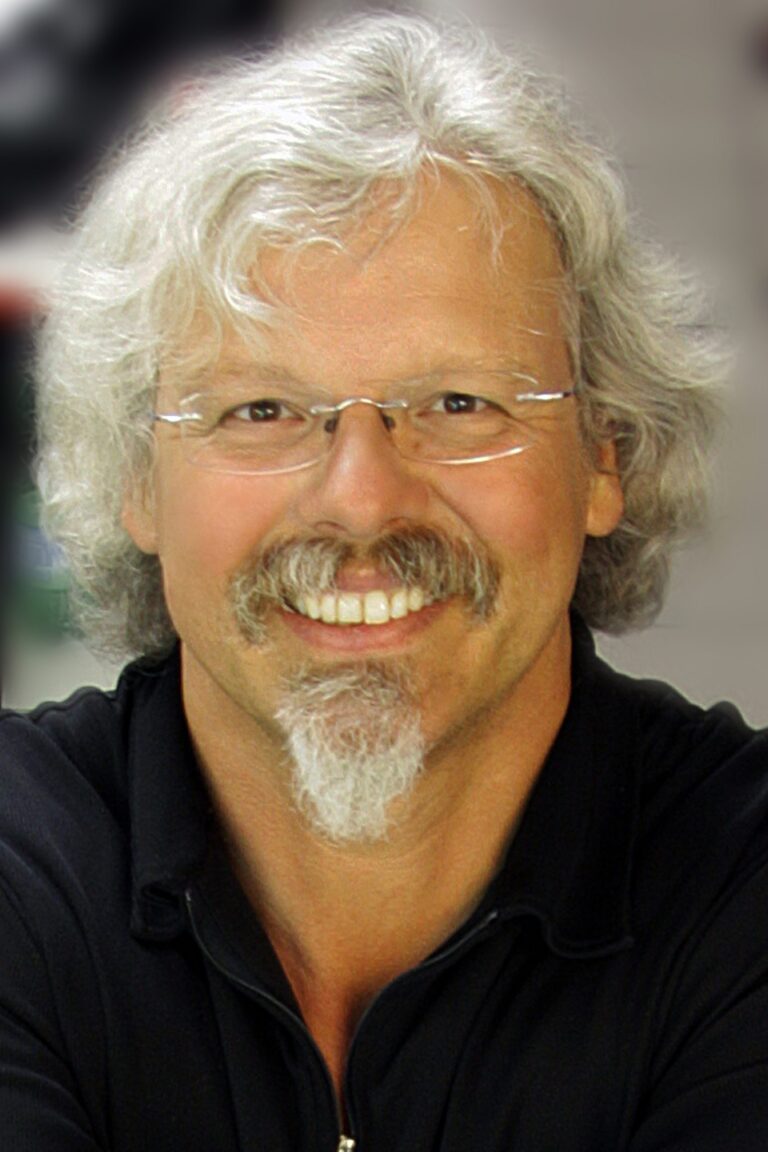
Als ich 1984 als 16-Jährige die ersten Spendensammlungen an meinem Gymnasium in Unterhaching durchführte, blickte sie gemeinsam mit Karlheinz Böhm von den offiziellen Plakaten von Menschen für Menschen: das Mädchen Sa’an. Auch auf Autogrammkarten und in den ersten Büchern über die Arbeit der Organisation war ihr Bild zu sehen.
Gemeinsam mit ihren Eltern hatte sie Anfang der 80er Jahre in eben jenem Flüchtlingslager am Rande des ostäthiopischen Städtchens Babile vor Krieg und Dürre Zuflucht gesucht, in das die lokalen Behörden den Gründer unserer Organisation geführt hatten, nachdem er im Zuge seiner spektakulären Fernsehwette seine Unterstützung angeboten hatte.

Symbolfigur für viele Menschen
Gemeinsam mit ihren Eltern und ein paar Tausend anderen Männern, Frauen und Kindern aus diesem und einem benachbarten Lager folgte sie ihm ins nahe gelegene Erer-Tal, um mithilfe der ersten Spendengelder an den Ufern des Flüsschens nach und nach vier Dörfer mit Wasserstellen, Schulen, Krankenstation und fruchtbaren Feldern aufzubauen, die ihre neue Heimat werden sollten.
Im Laufe der Jahre wurde die kleine Sa’an zu unserer Symbolfigur für all die Menschen, denen das Schicksal so vieler Entwurzelter, die am Rande des Verhungerns in dauerhafte Abhängigkeit von den Almosen internationaler Nahrungsmittelhilfe geraten, durch wirkungsvolle Hilfe zur Selbstentwicklung erspart werden konnte. In dieser Eigenschaft zierte das Foto von Sa’an dann auch noch die Titelseite der Broschüre zum 15-jährigen Jubiläum unserer Organisation, die ich selbst – inzwischen festangestellte Mitarbeiterin bei Menschen für Menschen – federführend mitgestalten durfte. Aber immer noch kannte ich das Mädchen auf dem Arm von Karlheinz Böhm nur von Bildern und aus Erzählungen.
Das Mädchen war inzwischen erwachsen geworden
Das sollte sich ändern, als ich Anfang der 2000er Jahre die Stelle der PR-Referentin in Äthiopien übernahm. Kurze Zeit später feierte unsere Organisation schon ihr 20-jähriges Bestehen, und Karlheinz Böhm war besonders stolz darauf, den internationalen Medienvertretern und -vertreterinnen ein ganz bestimmtes Wohnheim für Schüler und Schülerinnen präsentieren zu können, das gerade fertiggestellt worden war. Denn es befand sich in Babile – und zwar genau an der Stelle, an der rund zwei Jahrzehnte vorher die armseligen Zelte der Flüchtlingsfamilien gestanden hatten.
Ihre Kinder und Enkel waren es nun, die nach dem Abschluss der Grundschulen im Erer-Tal weiterführende Bildungseinrichtungen in der Stadt besuchen wollten und im neu gebauten Wohnheim die dafür nötige Unterkunft fanden. Auf der Eröffnungsfeier beschrieben Vertreter und Vertreterinnen der vier Dörfer in rührenden Worten den erfolgreichen Weg, den sie gemeinsam mit Menschen für Menschen beschritten hatten.
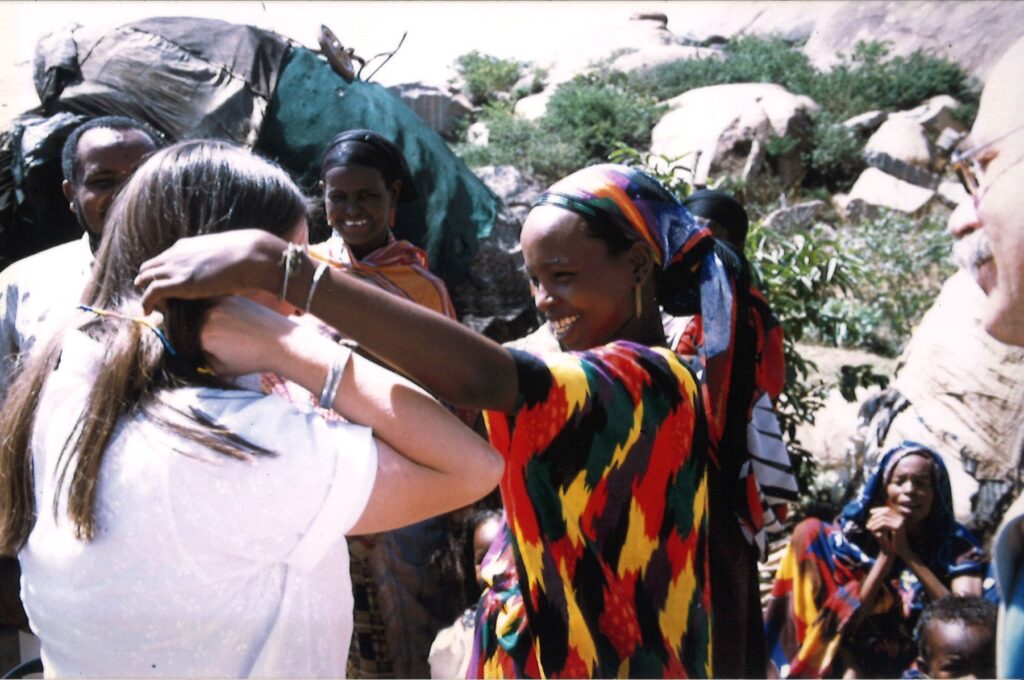
Als eine strahlende junge Frau auf uns zukam, um Karlheinz Böhm und sein Team im Anschluss an die Veranstaltung zu sich nach Hause auf einen Kaffee einzuladen, stand ich mit einem Mal dem inzwischen erwachsen gewordenen Mädchen von unseren ersten Werbeplakaten tatsächlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber!
Enge Beziehung zu den Menschen in den Projektgebieten
Ein bewegender Moment, der die enge persönliche Beziehung, die unsere Organisation zu den Menschen in den Projektgebieten hat, wieder einmal unterstrich und an den mich heute noch die bunte Perlenkette erinnert, die Sa‘an mir zur Begrüßung um den Hals gelegt hat. Wir unsererseits konnten ihr beim nächsten Treffen mit ein paar englischen Belegexemplaren von der Broschüre, mit der sie als „cover girl“ bei uns Geschichte geschrieben hatte, eine große Freude bereiten.

Michaela Böhm kam bereits 1984 als ehrenamtliche Helferin zu Menschen für Menschen und arbeitete bald schul- bzw. studienbegleitend in der PR-Abteilung mit. Anschließend wurde sie in Vollzeit von der Stiftung übernommen und war – mit Ausnahme von ein paar Jahren in anderen Unternehmen – zwei Jahrzehnte als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit sowie als persönliche Assistentin von Karlheinz und Almaz Böhm im Einsatz, u.a. auch mehrere Jahre in Äthiopien. Seit 2014 unterstützt sie den Vorstand und Stiftungsrat von MfM-Deutschland.
„Die Hungersnot in Äthiopien 1984/1985 war auch in den deutschen Medien über einen sehr langen Zeitraum ein vorherrschendes Thema. Für mich persönlich war es der Auslöser, mich – damals noch als Schüler – zu engagieren und von Deutschland aus etwas gegen die Hungersnot zu tun.
Gemeinsam mit ein paar Freunden startete ich an unserer Schule eine Aktion, die darauf aufmerksam machen sollte, dass jeden Tag über 40.000 Kinder unter fünf Jahren verhungerten – eine Zahl, so groß, dass man sich darunter gar nichts mehr vorstellen kann. Um dies den Menschen vor Augen zu führen, bauten wir aus Streichhölzern einen „Miniatur-Friedhof“ für den Planeten, klebten insgesamt als Mahnmal gegen den Hungertod 40.000 kleine Kreuze auf eine riesige Platte. Diese wollten wir dann zur Jubiläumsfeier von Ebingen, der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, ausstellen.
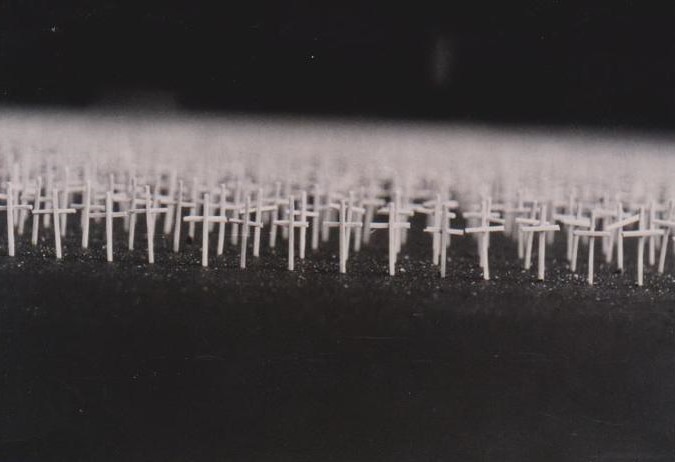
Außerdem schrieben wir mehrere Organisationen an, die in Äthiopien aktiv waren, um ihnen von unserer Aktion zu erzählen und sie zu der Jubiläumsfeier unserer Stadt einzuladen. So schickten wir auch eine schriftliche Einladung an Karlheinz Böhm – auf die wir jedoch nie eine Antwort bekamen. So ein arroganter Schauspieler, dachte ich mir damals, schafft es noch nicht mal, auf meinen Brief zu reagieren. Aber vielleicht war es auch naiv gewesen, zu glauben, dass er tatsächlich auf den Brief eines Schülers antworten würde.
"Plötzlich stand Karlheinz Böhm vor mir"
Am Tag vor der Jubiläumsfeier bauten meine Freunde und ich dann unser Mahnmal in der Stadt auf. Plötzlich kam ein Bekannter von mir um die Ecke und erzählte, dass er gerade Karlheinz Böhm in seinem Laden, einem kleinen lokalen Supermarkt, gesehen hätte. Wir glaubten ihm natürlich kein Wort. Doch am nächsten Tag zeigte sich, dass er recht gehabt hatte. Ohne Vorankündigung stand plötzlich Karlheinz Böhm vor mir und schaute sich unser gerade aufgebautes Mahnmal an.
In einer Kleinstadt wie meiner war ein solcher Besuch von außerordentlicher Popularität und für einen jungen Schüler, der bisher gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Prominenten gehabt hatte, selbstverständlich ein ganz besonderes Erlebnis.
Ein unkonventioneller Mensch
Einen halben Tag war Karlheinz Böhm in unserer Stadt, lobte unsere Aktion und bestärkte uns in unserem Handeln. Das Engagement junger Menschen war Karlheinz Böhm immer ein großes Anliegen. Fast jeden Tag, den er in Deutschland war, reiste er an Schulen, hielt Vorträge, und bewegte junge Menschen dazu, ihre Sichtweise auf die Welt zu überdenken, sich aktiv für in Armut lebende Menschen einzusetzen.
Überraschungen, wie auch der Besuch in meiner Kleinstadt, waren immer Karlheinz Böhms Spezialgebiet. Er war ein unkonventioneller Mensch, der, auch durch seinen Beruf als Schauspieler, genau wusste, wie man Menschen packt und berührt.“
Schon 1984 begann Axel Haasis als Schüler, ehrenamtlich für Menschen für Menschen zu arbeiten und setzte dieses Engagement auch während seines Studiums fort. Von 1993 bis 2013 war er hauptamtlich für die Stiftung tätig, zunächst als Leiter der Fundraising-Abteilung (bis 2002), dann als Geschäftsführer.

„Ich war gerade in die Oberstufe der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Berlin Tempelhof gekommen, als meine Schule mal wieder prominenten Besuch bekam. Die Schule hatte schon immer Wert daraufgelegt, bekannte Leute aus Politik und Gesellschaft für Vorträge und Diskussionsrunden einzuladen. Nun, am 13. November 1986, war Karlheinz Böhm groß angekündigt, der Schauspieler, der eine komplette Hilfsorganisation aufgebaut hat.
Ich kannte Karlheinz Böhm schon von der berühmten „Wetten, dass…?“ Sendung, wollte auch deshalb unbedingt bei dem Vortrag dabei sein. Während seines Besuchs wurde mir dann schnell klar, dass dieser Mann anders war. Nicht wie viele der steifen Politikerinnen und Politiker, die wir sonst zu Gast hatten. Karlheinz Böhm benutzte nicht das für ihn aufgebaute Rednerpult, sondern setzte sich spontan auf einen Tisch, hatte das Hemd hochgekrempelt und band uns Schülerinnen und Schüler in seinen Vortrag ein.
Mir ist immer im Kopf geblieben, dass er neben unserem sehr formellen Rektor fast jugendlich wirkte. Man fühlte sich von ihm ernst genommen, und vielleicht nahm man auch genau deshalb alles sehr ernst, was er uns erzählte. Er berichtete über die Hungersnot in Äthiopien, zeigte aber auch auf, wie er versucht, den Menschen vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen. Es war ein beeindruckender Tag. Doch, wie das bei Kindern und Jugendlichen eben oft so ist, nahm mich mein Schulalltag danach wieder völlig ein.
Zehn Jahre später – ich war inzwischen in der Ausbildung – war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mich aktiv engagieren wollte, voller Tatendrang, etwas zu bewegen und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Als ich überlegte, wo ich mich gut einbringen könnte, fiel mit der Schulbesuch Karlheinz Böhms und sein Hauptanliegen, dass wir alle etwas erreichen können, wenn wir uns aktiv einsetzen, wieder ein. Kurz entschlossen rief ich einfach mal im Münchner Büro der Stiftung an und fragte nach Möglichkeiten, mich ehrenamtlich zu engagieren.
Einstieg in den Arbeitskreis Berlin
So wurde ich bald Teil des Arbeitskreises in Berlin, über die nächsten Jahre organisierten wir viele verschiedene Spendenaktionen, waren auf Weihnachtsmärkten, nahmen an Veranstaltungen teil und motivierten so viele Menschen, mehr über Äthiopien und die Arbeit von Menschen für Menschen zu lernen. Ein Highlight war eine riesige Auktion, die wir organisierten, und auf der mehrere 10.000 Euro zusammenkamen.

Einmal jährlich gab es auch ein großes Treffen aller Arbeitskreise, dort traf ich auch immer mal wieder auf Karl und und seine Frau Almaz, allerdings meist in größerer Runde. Leider löste sich der Arbeitskreis dann irgendwann auf, viele Leute waren weggezogen oder zu alt geworden, ich suchte nach neuen Wegen, mich einzubringen.
Von der Ehrenamtskoordinatorin Melanie Koehler erfuhr ich, dass Menschen für Menschen immer noch Vorträge an Schulen anbot – dafür interessierte ich mich, der ja selbst durch einen Vortrag zum Engagement bewegt worden war, natürlich sehr. Außerdem sehe ich in den jungen Menschen so viel Potential, so viel Kraft und Energie, Dinge zu bewegen und Änderungen zu erreichen. So begleitete ich bald die Jugendreferentin der Stiftung bei einem ihrer Vorträge. Schnell war mir klar, dass ich mich genau hier weiter einbringen wollte. Da es auch mehr Anfragen von Schulen gab, als durch die Jugendreferentin alleine abgedeckt werden konnten, war mein Engagement hier auch bestens platziert.
Vorträge im Stile Karlheinz Böhms
Meinen ersten eigenen Vortrag über die Arbeit von Menschen für Menschen in Äthiopien hielt ich dann an der KGS Wiesmoor in Niedersachsen – und muss zugeben, dass ich wahnsinnig nervös war. Ich bin Geschäftsmann, Vorträge halte ich berufsbedingt regelmäßig, doch trotzdem klopfte mein Herz laut, als ich vor einer Aula voller Schülerinnen und Schüler stand.

Das Interesse von Kindern und Jugendlichen zu wecken und sie zu begeistern, ist etwas ganz Anderes, als alles, was ich durch meinen Beruf gewöhnt war. Mich an 1986 erinnernd, gestaltete ich die Vorträge eher à la Böhm, als lockeren und interaktiven Austausch, um die Kinder und Jugendlichen einzubinden und mitzunehmen.
Inzwischen halte ich – wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht – regelmäßig Schulvorträge in ganz Deutschland, erzähle jungen Menschen von Äthiopien und der Arbeit vor Ort. So gebe ich weiter, was auch ich damals aus dem Schulbesuchs Karlheinz Böhms mitgenommen habe: Um wirklich was zu verändern, muss man einfach anpacken, etwas machen, nicht nur überlegen und darüber reden. Bei Menschen für Menschen steht das „Machen“ immer an erster Stelle – und wird es auch die nächsten 40 Jahre weiterhin tun.

Nach seinem Schulabschluss fing Dirk Kasten 1998 an, sich ehrenamtlich im Arbeitskreis Berlin für MfM zu engagieren. 2018 wurde er zum Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung berufen und ist für die Generierung von Spenden und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Mit seiner eigenen Stiftung finanziert er gemeinsam mit Menschen für Menschen verschiedene Projekte, darunter Frauen-Förderprogramme und den Bau von Schulen.


„Unser Arbeitsansatz ist, die Menschen im ländlichen Äthiopien so zu unterstützen, dass sie ihr Leben aus eigener Kraft verbessern und selbstbestimmt gestalten können. Das klingt immer erstmal gut und überzeugend. Doch was verbirgt sich in der Umsetzung dahinter? In den letzten Jahren habe ich durch viele unterschiedliche Begegnungen in Äthiopien immer wieder gesehen, wie dieser Ansatz in der Praxis aussieht – und noch viel wichtiger: dass er funktioniert und der richtige Weg ist, um langfristige und nachhaltige Verbesserungen zu erreichen.
Hilfe zur Selbsthilfe kann dabei ganz unterschiedlich aussehen, entwickelt sich weiter, passt sich an die lokalen Umstände an. An zwei Begegnungen erinnere ich mich ganz besonders, welche mich in meiner Arbeit motivieren und zeigen, dass das, was wir machen, wirkt.
Impulse weiterentwickelt
2016 war ich in unserem Projektgebiet Dale Wabera. Dort setzten wir im ländlichen Raum viele Maßnahmen im Bereich WaSH (Wasser, Sanitäre Einrichtungen, Hygiene) um, darunter den Bau von Waschplätzen und Toiletten sowie Schulungen und Aufklärungskampagnen zum richtigen Hände- und Gesichtwaschen. In diesen Schulungen erklären lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Menschen, wie wichtig das Händewaschen nach dem Toilettengang ist, und dass immer ein Wasserkanister und Seife dafür bereitstehen sollten.
Nun war ich bei einem Bauern zu Besuch, um zu sehen, wie unsere Arbeit bei ihm ankam. Während ich mich umschaute, entdeckte ich, dass vor der Toilette eine sonderbare Konstruktion hing.
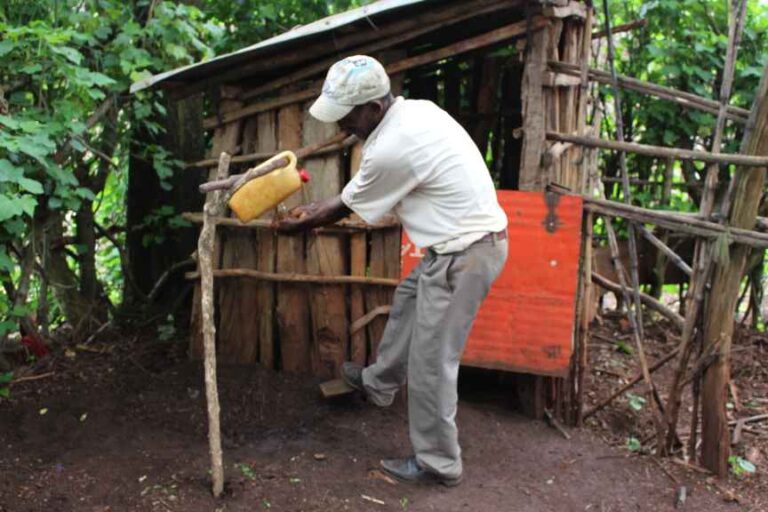
Beim näheren Hinschauen sah ich, dass der Bauer einen Wasserkanister zum Händewaschen an einem Gestell aus zwei Ästen aufgehängt hatte und eine bis zur Knöchelhöhe reichenden Schnur mit einem flachen Holzstück daran befestigt war. Er erklärte mir, dass er ja in den Trainings gelernt hatte, wie gesundheitsschädlich die Bakterien und der Schmutz sind – und so erschien es ihm konsequent, den Kanister beim Händewaschen nicht anzufassen. Er musste anders gekippt werden. Diese Idee hatte er nicht von uns, er hat unsere Impulse aus den Schulungen durchdacht und weiterentwickelt. Ich war begeistert!
Geschäftstüchtige Töpferinnen
Ein weiteres tolles Beispiel, wie Hilfe zur Selbsthilfe wirken kann, ist eine Gruppe von Frauen aus unserem Projektgebiet in Wore Illu, die von MfM zu Töpferinnen ausgebildet wurden. In unseren Schulungen lernten sie viel über die richtige Mischung der Materialien und den Umgang mit der Töpferscheibe und waren nach der Schulung schon in verschiedenen Formen ganz aktiv, um mit dem Töpfern Geld zu verdienen.

Bei einem Besuch fragte ich sie, was sie mit ihren Einnahmen machten. Sie erzählten mir, dass sie ein wenig davon für Dinge ausgeben, die ihre Kinder benötigen: Hefte, Stifte oder mal ein neues Kleidungsstück. Den größten Teil würden sie aber auf ein Konto anlegen. Auf die Frage warum, berichteten sie mir von ihrem Plan, gemeinsam in einiger Zeit eine Getreidemühle zu kaufen. Da Mehl mahlen in Äthiopien oft noch schwierig ist, wissen die Frauen, dass sie mit einer Mühle mehr Geld machen und sich langfristig etwas Größeres aufbauen können.
Ein Jahr später war ich nochmal vor Ort, und die Frauen hatten es schon geschafft, ihr angelegtes Geld zu verdreifachen! Die Frauen haben von uns kein Kapital, sondern nur einen Töpferkurs erhalten.

Doch das Beispiel zeigt, was mit einer so kleinen Unterstützung ins Rollen gebracht werden kann, und dass alle weiteren Überlegungen und Entwicklungen von alleine, aus der Initiative der Menschen heraus entstehen. Diese Frauen hatten sich zu selbstbewussten Geschäftsfrauen entwickelt!
Es sind solche Begegnungen und Erlebnisse, die mir zeigen, wie richtig und wichtig unser Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe ist, und wie viel dadurch entstehen kann und weiterhin entstehen wird.“
In ihrer Kindheit und Jugend lebte Elyane Schwarz-Lankes ein paar Jahre in Äthiopien und fühlt sich dem Land so schon immer verbunden. Bereits ab 1990 war sie als Pressesprecherin für die Stiftung Menschen für Menschen tätig. Zwischendurch als freie Angestellte im Fundraising und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, arbeitet sie seit 2013 als Referentin in der Entwicklungszusammenarbeit als Brückenposition zwischen dem deutschen und äthiopischen Büro.
„Vor 40 Jahren war ich Angestellter bei der „Relief and Rehabilitation Commission“ der äthiopischen Regierung und arbeitete als Traktorfahrer im Erer-Tal im Osten Äthiopiens. Eines Tages traf ich so auf Karlheinz Böhm, den „Faranji“ (fremden Gast), der vorübergehend im Bisidemo Hospital, einem von Deutschland finanzierten Lepra-Krankenhaus, untergebracht war.
Ich sah ihn zuerst ganz zufällig an einer Tankstelle, wo ich ihm half, Benzin in sein Auto zu füllen. Er bedankte er sich und gab mir 10 Birr. Ich konnte ihm leider nicht auf Englisch antworten und so schüttelte ich nur meinen Kopf auf und ab. Er lächelte und hielt mich an den Schultern fest: „My name is Karlheinz. Nice to meet you!“
"Ich habe viel von Karlheinz Böhm gelernt"
Ab diesem Tag half ich ihm immer beim Tanken seines Autos, wenn wir gleichzeitig vor Ort an der Tankstelle waren. Eines Tages fragte er mich nach meinem Beruf. Mit Händen und Füßen erklärte ich ihm, dass ich Traktorfahrer sei. Daraufhin bot er mir an, für ein besseres Gehalt als mein damaliges bei ihm zu arbeiten. Ich dachte eine Weile darüber nach, machte noch einen offiziellen Führerschein (den ich davor nicht besaß) und wurde schließlich bei der Stiftung als Fahrer angestellt.
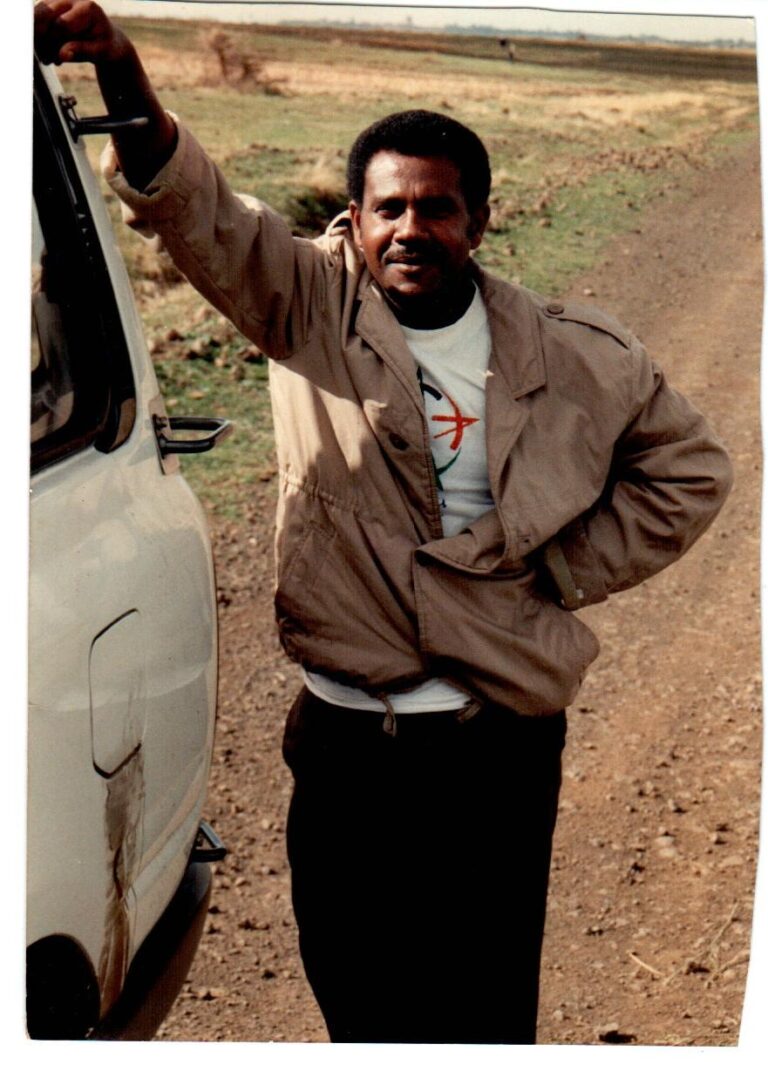


So war ich mehr als 20 Jahre lang der Fahrer von Karlheinz Böhm. Viel habe ich in der Zeit von ihm gelernt: wie man effizient arbeitet, die Zeit des Tages gut einteilt und das Wichtigste: wie man jedem Menschen Liebe und Respekt entgegenbringt.
Doch manchmal fiel es mir auch schwer, ihn zu verstehen. Einmal war Karl gerade aus Deutschland gekommen und wir reisten, nachdem ich ihn vom Flughafen in Addis abgeholt hatte, direkt in die Projektgebiete. Als wir einem der Projektbüros ankamen, hatte das Team vor Ort bereits alles für den Besuch vorbereitet.
"Man sollte nicht immer mit dem Strom schwimmen"
Doch Karl weigerte sich, die für ihn vorbereitete Besuchstour zu absolvieren, was große Verwirrung auslöste. Stattdessen bat er mich, ihn an andere Orte im Projektgebiet zu fahren. Diese waren natürlich nicht auf seinen Besuch vorbereitet, und so erlebte Karlheinz das Alltagschaos und konnte auch einige Dinge beobachten, die noch nicht erledigt worden waren. Während wir zurückfuhren, sagte er etwas auf Englisch, was sein Übersetzer an mich weitergab: „One should not always flow via a canal built for him.“ Man sollte nicht immer mit dem Strom schwimmen.
Dieses Zitat und diese Erfahrung haben mir sehr geholfen, auch in meinem persönlichen und familiären Leben. Man sollte sich immer ein eigenes Bild machen und nicht nur dem folgen, was andere uns vorgeben und sehen lassen wollen. Es ist dieser Ansatz, der die Arbeit von MfM so wirkungsvoll gemacht hat. Bis heute folgen die Projektleiter diesem Ansatz, mit dem Ergebnis, dass die Qualität der Projekte und die Leistungen der Stiftung weiterhin hervorragend sind.“
Mekonnen Kassa, 66 Jahre, wurde – eher durch Zufall – in den Achtziger Jahren der zweite Menschen für Menschen-Mitarbeiter in Äthiopien. Bis 2019 war er für die Stiftung aktiv, dabei bis zum Tod Karlheinz Böhms als dessen Fahrer. Doch er war auch immer so viel mehr als das, und wurde als landeskundiger Berater zu einem engen Freund und Vertrauten Karlheinz Böhms.

„Zum ersten Mal traf ich Karlheinz Böhm am 22. Dezember 1991. Wir waren als Crew eines A300 auf einem sechstägigen Lay-Over über Weihnachten im Addis Hilton Hotel untergebracht. Ich saß spätmorgens am Pool, trank einen schönen äthiopischen Kaffee und las eine deutsche Zeitung vom Abflugtag, als plötzlich ein angegrauter Herr an meinen Tisch kam und fragte: „Sind Sie von der Lufthansa?“ Ich blickte hoch, bejahte und erkannte sofort, wer der Herr war: Karlheinz Böhm.
Er stellte sich vor, worauf ich nur erwiderte, dass ich natürlich weiß, wer er sei, und fragte, ob er sich zu mir an den Tisch setzen könnte. Wir begannen das erste von vielen Gesprächen, die über die nächsten Jahre noch folgen sollten. Es war wahnsinnig interessant, was Herr Böhm alles von seiner Arbeit mit seiner Organisation Menschen für Menschen zu berichten hatte. Wir trafen uns dort täglich während des gesamten Lay-Overs.
Spontane Spendenaktion für Menschen für Menschen
Am 24. Dezember waren wir – wie damals üblich – im Hotel zum Abendessen von Lufthansa eingeladen, die gesamte Crew plus sieben Angehörige, also in etwa 18 Personen. Ich stand noch unter dem Eindruck der Unterhaltungen mit „Mr. Karl“, wie er respekt- und liebevoll von den Äthiopierinnen und Äthiopiern genannt wurde. Ich erzählte der Crew von den Gesprächen mit ihm und mir fiel spontan ein, für seine Organisation innerhalb der Crew plus Angehörigen eine Spendensammlung – natürlich auf freiwilliger Basis – durchzuführen.
Das Ergebnis war für mich überraschend und überwältigend, es kamen 720 D-Mark zusammen! Da jedes Crewmitglied in Addis Abeba eine „Money Declaration“ über die mitgeführten Gelder ausfüllen musste (wegen des Währungsschwarzmarkts), erklärte ich mich bereit, Herrn Böhm einen Euroscheck von mir über die Summe im Namen der Crew zu übergeben und das Bargeld dann nach Abflug in Addis Abeba einzusammeln.
Lockere Freundschaft mit Karlheinz Böhm
Am 26. Dezember traf ich Herrn Böhm wieder mit seiner Frau Almaz und Söhnchen Nicolas im Hotel und übergab ihm dort den Scheck. Zuerst war er sprachlos und gerührt, dann nahm er mich ganz fest in seine Arme und ich sah seine feuchte Augen. Er sagte nur zu mir, dass die Höhe der gesammelten Spende für ihn gar nicht so relevant sei, sondern dass die Bereitschaft für eine Spende, und wenn es nur fünf D-Mark seien, viel mehr zähle als alles andere. Anschließend hat er sich bei jedem einzelnen anwesenden Crewmitglied persönlich mit Handschlag bedankt.

Daraus entstand eine lockere Freundschaft über Jahre bis zu meinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Ich habe Herrn Böhm bei jedem meiner vielen Flüge nach Addis besucht und wurde auch des Öfteren zum Abendessen in seinem bescheidenen Häuschen eingeladen. Augenzwinkernd meinte er, dass ich aber nur zum Essen kommen dürfe, wenn ich ihm backfrisches Roggen- und Körnerbrot aus Deutschland mitbringe. Also bin ich vor der Fahrt zum Briefing oft noch schnell bei meinem Bäcker vorbei und habe drei Laibe à zwei Kilogramm Brot gekauft – was ich mit Freude getan habe – die er dann noch abends im Hotel abholte.
Wiedersehen in Karlheinz Böhms Geburtsstadt
Leider habe ich es zeitlich nie geschafft, in eines der vielen Projektgebiete von Menschen für Menschen mit zu fahren, obwohl Karlheinz Böhm mir das angeboten hat. Er war und ist für mich einer der bemerkenswertesten Menschen, die ich je kennen lernen durfte.
Lange nach der Beendigung meiner Tätigkeit bei der Lufthansa hat Herr Böhm einen Vortrag über seine Arbeit in seiner Geburtsstadt Darmstadt gehalten, zu dem ich hingefahren bin. Unter den etwa 100 Zuhörern und Zuhörerinnen hat er mich zuerst nicht erkannt, aber später bemerkte ich, dass sein Blick des Öfteren auf mich fiel. Am Ende des Vortrags war ihm dann wohl eingefallen, wer ich war, er bat mich nach vorne und erzählte von unseren gemeinsamen Zusammenkünften in Addis Abeba und der Unterstützung durch die Lufthansa-Crew. Das fand ich total toll.“
Reinhold Weber war von 1971 bis 2002 bei der Lufthansa tätig und als Chef der Kabinencrew zwischen 1991 bis 2002 mindestens 20 Mal in Addis Abeba. Auf diesem Wege lernte er dort Karlheinz Böhm und seine Frau Almaz Böhm kennen.
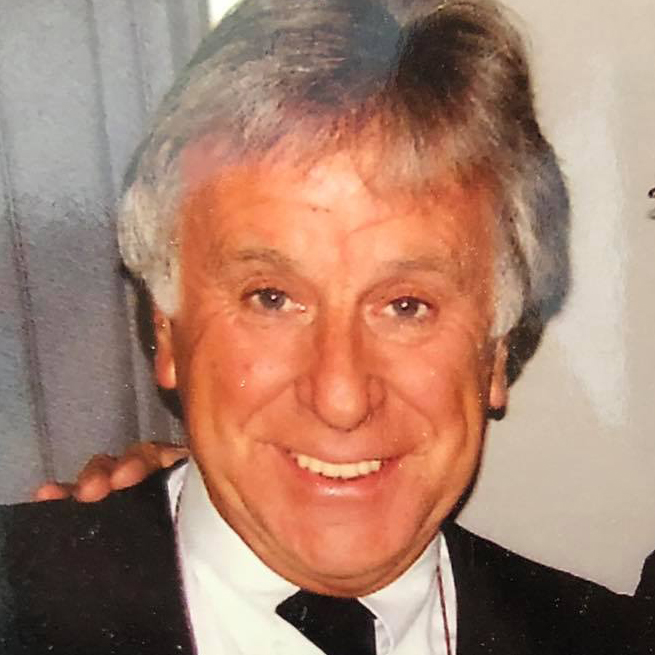
„“Meine Sportler aus Vechta.“ Mit offenen Armen und einem herzlichen Lächeln begrüßte Karlheinz Böhm immer die Vertreter und Vertreterinnen der Aktion „Sportler gegen Hunger“ (SgH), die 1984 vom Kreissportbund Vechta und der Oldenburgischen Volkszeitung Vechta gegründet wurde und bis heute die Stiftung Menschen für Menschen unterstützt – inzwischen mit über drei Millionen Euro. Erstmals kam es 1986 zu einem Treffen, danach in der Regel fast alle zwei Jahre irgendwo in Norddeutschland, um über die Arbeit in Äthiopien zu sprechen und auch um werbewirksame Scheckübergaben für die SgH-Aktion zu fotografieren.
Insgesamt viermal reiste Karlheinz Böhm auch in den Kreis Vechta. Unvergessen sein Besuch im Januar 2001, als er sich mit seiner Frau Almaz ein Wochenende lang unter die aktiven Sportler und Sportlerinnen mischte. MfM-Geschäftsführer Axel Haasis hatte zuvor bekräftigt, dass wir das Ehepaar Böhm für alles einplanen könnten. Sechs Termine an sechs Orten nahmen wir für die zwei Tage auf die To-Do-Liste.

Plötzlich verschwand Karlheinz Böhms Lächeln
Nach dem Einchecken im Hotel besprachen wir das Programm. Abendessen plus Vortrag mit rund 50 Vertretern und Vertreterinnen der aktivsten Vereine – Karlheinz Böhm nickte zustimmend. Ortswanderung mit rund 400 Sportlerinnen und Sportlern – er lächelte, forschen Schrittes war er schließlich immer in Äthiopien unterwegs. Symbolischer Anstoß bei einem Turnier oder Ziehen der Lose bei einer Tombola – alles kein Problem. Und dann noch zweimal Prominentenschießen.
Von der einen auf die andere Sekunde verschwand sein Lächeln, sein Gesicht nahm ernsthafte Züge an, es herrschte Stille. Wir waren ebenfalls verwirrt: Hatten wir was Falsches gesagt, was falsch gemacht? „Bei aller Liebe, Herr Schlömer…“, sagte Karlheinz Böhm, „egal wie, aber schießen auf Prominente kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“

Die knisternde Anspannung löste sich dann jedoch in Sekundenschnelle wieder auf: Beim Prominentenschießen im Fußball treten Prominente zu einem Elfmeterschießen gegeneinander an.
Kurz vor dem Rückflug trat das Ehepaar Böhm dann auch tatsächlich beim Prominentenschießen in Langförden an. Siegerin Lenchen Moormann, die Frau des Vereinsvorsitzenden, bekam den Pokal von Karlheinz Böhm überreicht. Diese Trophäe wird von ihr noch heute regelmäßig auf Hochglanz poliert, daneben steht im Schrank ein eingerahmtes Foto von der Pokalübergabe durch ihr Filmidol Karlheinz Böhm.
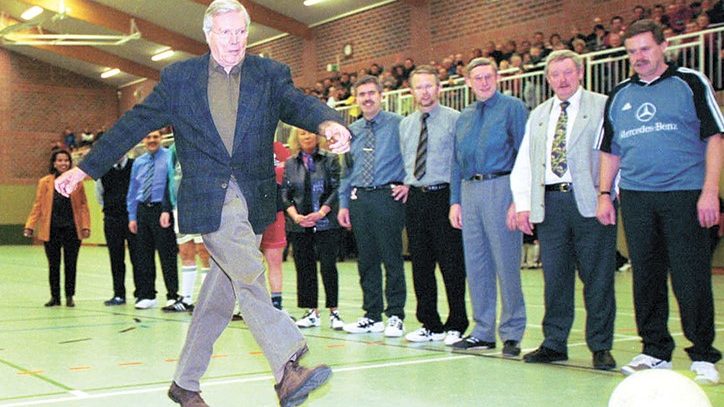

Ein kleiner persönlicher Triumph für Karlheinz Böhm
Dieser hatte zuvor im Gegensatz zu seiner Frau Almaz auch einmal getroffen. „Das war gut für die Moral“, zitierte die Oldenburgische Volkszeitung den damals 72-Jährigen. Beim Prominentenschießen tags zuvor in Lohne hatte Karlheinz Böhm dieses Familienduell nämlich mit 0:1 verloren. So verließ der MfM-Gründer nach der Verwirrung um das Prominentenschießen seine Sportler und Sportlerinnen aus Vechta mit einem kleinen persönlichen Triumph.“
Franz-Josef Schlömer ist der Initiator und Gründer der Aktion „Sportler gegen Hunger“ (SgH), welche seit 1984 und bis heute die Stiftung Menschen für Menschen unterstützt. Seit der Gründung bis 2018 war Herr Schlömer Vorsitzender von SgH, seitdem leitet Carsten Boning die Aktion.

„In unserem ehemaligen Projektgebiet Merhabete war er fast so etwas wie eine lokale Berühmtheit: der Bauer Gheset. Viele Jahre lang lebte er mit seiner Familie am Rande eines großen Erosionsgrabens und beobachtete mit wachsender Sorge, wie mit jeder Regenzeit etwas mehr von seinem Ackerland abgeschwemmt wurde. Nicht mehr lange und der Riss durch die Erde würde auch seinen Bauernhof erreichen.
Aber Gheset gab nicht auf, sondern nahm seine Chance wahr, als Menschen für Menschen in den Bezirk im zentraläthiopischen Hochland kam. Das Team bot den Bauern an, ihnen bei der Steigerung ihrer landwirtschaftlichen Erträge unter die Arme zu greifen, wenn sie im Gegenzug dabei halfen, etwas für die Konservierung der kargen natürlichen Ressourcen zu unternehmen.
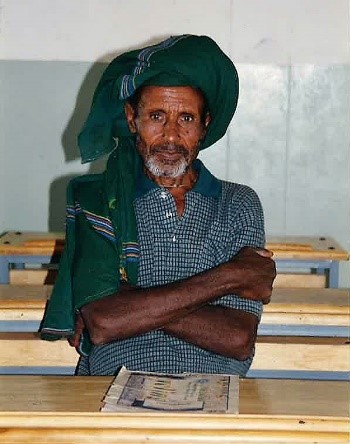
Als einer der Ersten pflanzte Gheset diverse Baumsetzlinge in den Graben hinter seinem Hof und baute kleine Steinwälle hinein, um so den Boden zu stabilisieren. Schon wenige Jahre später konnte er nicht nur vorzeigen, wie hoch die Bäume, Büsche und Gräser gewachsen waren, sondern auch, wie sich die Erde zwischen den Steinwällen sammelte und sich der Graben stetig füllte, anstatt immer tiefer zu werden.
Bessere Ernten, höheres Einkommen
Auch das, was er in unseren landwirtschaftlichen Trainingskursen lernen konnte, setzte er engagiert in die Tat um: einige Pflanzen aus dem Erosionsgraben nutzte er maßvoll als Viehfutter, um damit die Qualität seiner Milchkühe sowie deren Milchproduktion und den Verkaufspreis zu erhöhen. Auf Teilen seines Landes baute er Gemüse an und bereicherte so nicht nur den Speiseplan seiner Familie, sondern erzielte auf dem Markt zusätzliche Einnahmen. Und auch der Einsatz von Saatgut, das den lokalen Bedingungen besser angepasst war, half ihm dabei, seine Ernte und sein Einkommen zu steigern.
Seine Nachbarn und Nachbarinnen beäugten die Entwicklung seines Hofes teils neugierig, teils mit einem gewissen Neid. Aber Gheset gab sein neu erworbenes Wissen gerne weiter. Als sogenannter „Modellbauer“ empfing er immer wieder ganze Trainingseinheiten unserer landwirtschaftlichen Abteilung, um anschaulich zu demonstrieren, wie die theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden waren. Stolz und glücklich präsentierte er auch den Gästen aus Europa (im Bild z.B. der Fotograf Peter Rigaud aus Österreich) immer wieder, wie erfolgreich er mit seinen Maßnahmen gewesen war, weil er wusste, dass die Berichte im fernen Europa noch mehr Menschen motivieren würden, finanzielle Mittel für seine Heimat zu geben.
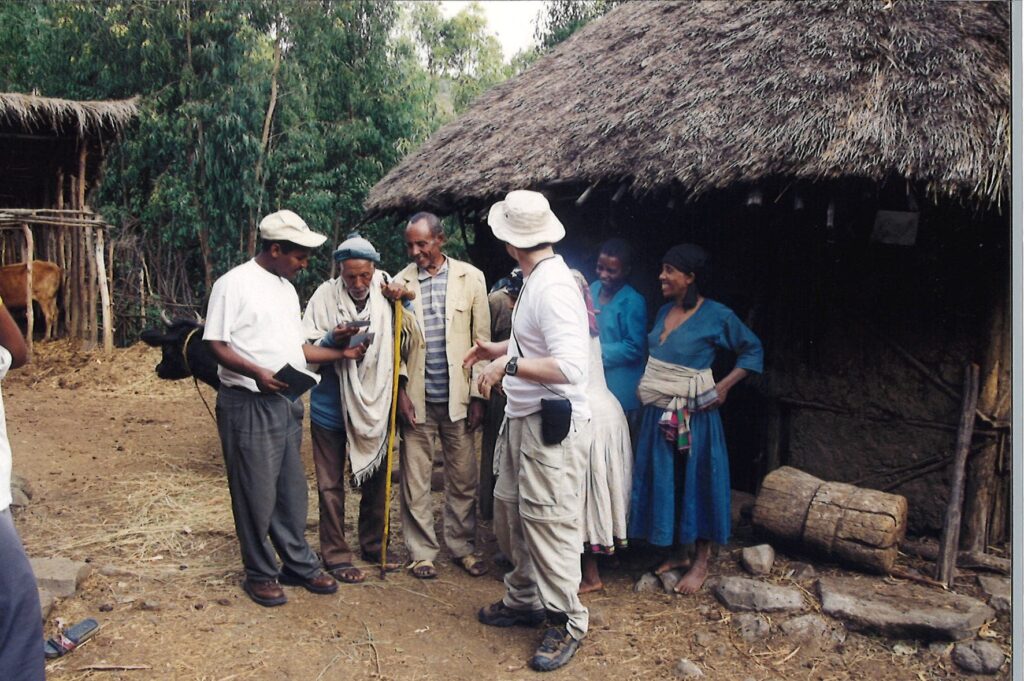
"Jetzt möchte ich gern noch einmal jung sein"
Aber damit nicht genug. Als Menschen für Menschen für seine Gemeinde die dringend benötigte Schule bauen wollte, aber nicht genügend geeigneter Baugrund vorhanden war, trat Gheset freiwillig und ohne Zögern einen Teil seines Grundstücks dafür ab. ‚Ihr habt mir geholfen, mein Land zu erhalten und besser zu nutzen, nun kann ich es mir leisten, für die nächste Generation etwas davon abzugeben.‘
Fasziniert sah er in den nächsten Monaten zu, wie die Fundamente gelegt und Gebäude um Gebäude hochgezogen wurde. Noch vor der offiziellen Eröffnung besichtigte er das Schulgelände und setzte sich in einem der neuen Klassenzimmer in eine Schulbank – zum ersten Mal in einem seinem Leben! Auf die Frage, ob er sich freue, dass so viele Kinder nun unter besseren Bedingungen lernen können, antwortete er mit Tränen in den Augen: ‚Ja, sehr! Aber jetzt möchte ich gerne selbst noch einmal jung sein…'“
Michaela Böhm kam bereits 1984 als ehrenamtliche Helferin zu Menschen für Menschen und arbeitete bald schul- bzw. studienbegleitend in der PR-Abteilung mit. Anschließend wurde sie in Vollzeit von der Stiftung übernommen und war – mit Ausnahme von ein paar Jahren in anderen Unternehmen – zwei Jahrzehnte als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit sowie als persönliche Assistentin von Karlheinz und Almaz Böhm im Einsatz, u.a. auch mehrere Jahre in Äthiopien. Seit 2014 unterstützt sie den Vorstand und Stiftungsrat von MfM Deutschland.
„Kennengelernt habe ich Karlheinz Böhm über den Arbeitskreis von Menschen für Menschen in Erlangen. Als wir unseren Circus Sambesi 1987 gründeten, hörte die damalige Leiterin des dortigen Arbeitskreises davon in den lokalen Nachrichten und lud unseren Zirkus für eine Vorstellung nach Erlangen ein. Ohne unser Wissen schickte sie auch eine Einladung an Karlheinz Böhm. Die Aufführung fand dann im Mai 1988 in Anwesenheit von Karlheinz Böhm statt, der – trotz unseres bis dahin sehr bescheidenen Zirkusdaseins – direkt total begeistert war.
Als langjähriger Afrikaliebhaber fand ich großen Gefallen am Anliegen Karlheinz Böhms, und so beschlossen wir, fortan die Einnahmen aus dem Zirkusbetrieb an die Stiftung Menschen für Menschen zu spenden. Bis heute war ich zweimal auf Einladung von Menschen für Menschen in den Projektgebieten der Stiftung in Äthiopien, dabei haben wir auch zwei Schulen eingeweiht, die durch unsere Unterstützung finanziert werden konnten und die den Namen unseres Circus Sambesi tragen.
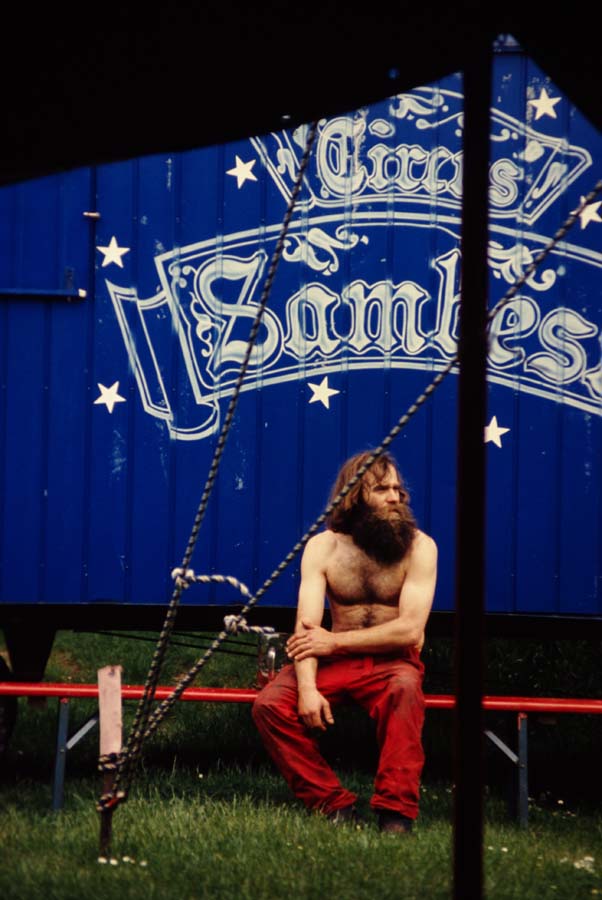
Mittagessen mit Karlheinz Böhm und Landrat Hans Schuierer
Eine kleine Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist, stammt aus dem Sommer 1993. Mit dem Circus war eine Vorstellung in Schwandorf geplant. Als Karlheinz Böhm davon hörte, beschloss er, uns dort zu besuchen und dies auch mit einem Treffen mit dem damaligen Landrat Hans Schuierer zu verbinden. Der Plan von Karlheinz Böhm war ein gemeinsames Mittagessen mit dem Herrn Landrat und mir und eine anschließende Pressekonferenz vor der Nachmittagsvorstellung unseres Circus. Er bat mich, dies zu arrangieren und dafür das Hotel Bayer, nahe des Standorts unseres Circus, anzufragen.
Wir kamen mit dem Circus schon einige Tage vorher in Schwandorf an und um für den Samstag alles zu organisieren, ging ich einige Abende vorher in das Hotel Bayer und sprach dort mit der Oberkellnerin. Ich erzählte ihr, dass am Samstagmittag Karlheinz Böhm und der Landrat Schuierer mit mir hier zu Mittagessen würden und wir anschließend einen Raum für die Pressekonferenz bräuchten.
"Die Oberkellnerin hielt mich für einen Hochstapler - bis die Tür aufging"
Sie nickte und schrieb sich alles auf, doch als ich das Hotel wieder verließ, war ich mir hundertprozentig sicher, dass sie mir nichts davon geglaubt hatte. Wer weiß, wie ich aussehe, mit meinem – inzwischen grauem – Vollbart, versteht vielleicht, warum mir dies so schien. Das ist voll in die Hosen gegangen, dachte ich mir noch, und rief sogar im Landratsamt an, um den Landrat davon in Kenntnis zu setzen.
Am Samstag selbst ging ich dann mittags wieder ins Hotel Bayer, dieses Mal zwar besser angezogen, aber schon bei meinem Eintreten merkte man, dass die Oberkellnerin mich immer noch für einen Hochstapler hielt. Ich ließ mich davon nicht beirren, setzte mich auf die Terrasse, und wartete auf die anderen.
Erfolgreiche Vorstellung und eine Extra-Spende für Menschen für Menschen
Dann ging die Tür auf und Karlheinz Böhm trat mit seiner Frau ein. Die Oberkellnerin, das habe ich bis heute vor Augen, stand da wie zur Salzsäure erstarrt. Es stellte sich heraus, dass sie ein großer „Sissi“-Fan war, und ihren Augen kaum trauen wollte. Später gestand sie mir, dass sie mir tatsächlich bis zum Eintreten von Herrn Böhm nichts von meiner Geschichte geglaubt hatte.
Nach einer erfolgreichen Nachmittagsvorstellung des Circus wurden wir dann alle im Hotel noch zum Abendessen eingeladen, und das Hotel spendete sogar 1.000 DM an Menschen für Menschen. Auch der Landrat Schuierer legte nochmal eine große Summe dazu – sodass dieser Tag nicht nur so manche eines Besseren belehrte, sondern auch noch tolle Spendeneinnahmen für die Stiftung brachte.“ —
Mit der Gründung des Circus Sambesi erfüllte sich der Neumarkter Karl Nidermayer einen Kindheitswunsch. 1987 erwarb Nidermayer das blaue Zwei-Mast-Zelt, schon kurz darauf fand die erste Vorstellung statt – die Einnahmen des Wohltätigkeitszirkus gehen seitdem an Menschen für Menschen, mehr als 750.000 Euro kamen so in den vergangenen über drei Jahrzehnten zusammen.
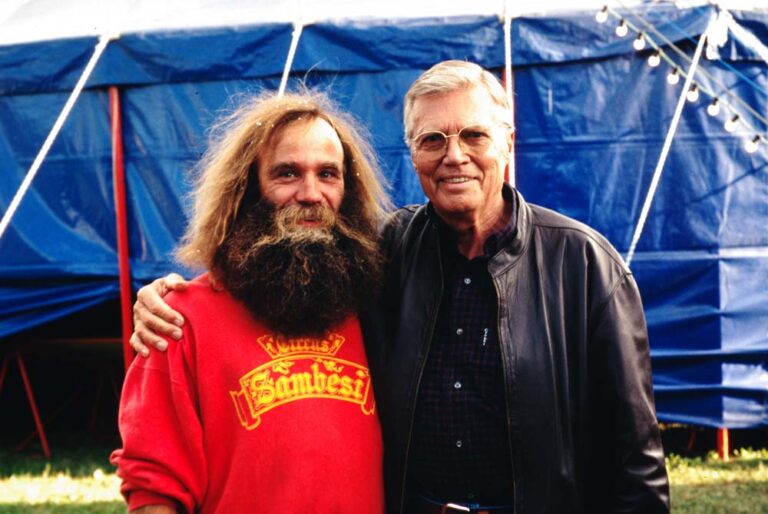
Einmaliges Engagement: Impressionen aus 34 Jahren Circus Sambesi
Das „Mettu Karl Krankenhaus“ liegt im südlichen Teil der Stadt Mettu, der Hauptstadt des Regierungsbezirks Illubabor im Regionalstaat Oromia. An der Südwestseite des Krankenhauses fließt ein Bach, der auch in den Trockenperioden noch genügend Wasser führt. Dieser Bach diente als Waschplatz für eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die besonders an den Wochenenden kamen, um ihre Kleidung zu reinigen.
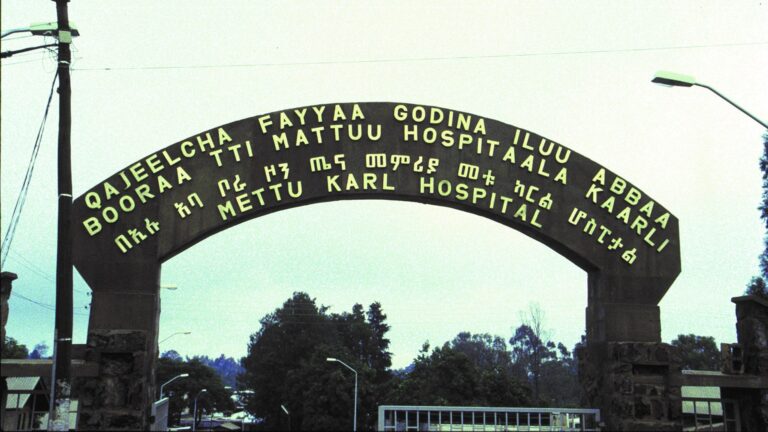

Der Bach war durch das Fenster meines damaligen Büros im Mettu Karl Krankenhaus zu sehen. Als Karlheinz Böhm einmal in meinem Büro stand und durch das Fenster schaute, sah er Menschen, die ihre Kleidung direkt am Fluss wuschen, einige von ihnen badeten auch darin. Ihm fiel sofort auf, wie umständlich es für die Menschen war, gleichzeitig dort ihre Kleidung zu waschen – und gleichzeitig auch, wie sehr der Fluss dadurch verschmutzt wurde.
Großer positiver Effekt bei minimalen Kosten
An Ort und Stelle beauftragte er den Bau eines Waschplatzes mit verschiedenen Trennwänden und einer Sickergrube zur Ableitung des Wassers, um die Verschmutzung des Flusses zu minimieren und die Arbeit zu erleichtern. Bedacht auf minimale Kosten wurde die Maßnahme umgesetzt, und die Auswirkungen, die dies hatte, waren sowohl für die betroffenen Menschen als auch für die Umwelt von großer positiver Bedeutung.
Mich hat diese spontane Handlung von Karl viel gelehrt: Sie zeigt, dass man auch mit minimalen Mitteln etwas tun kann, um Menschen zu helfen und gleichzeitig die Umwelt zu erhalten. Ich glaube, dass Karlheinz Böhm seiner Zeit voraus war und die vom Menschen verursachte Umweltzerstörung und -verschmutzung wahrgenommen hat, bevor die meisten Menschen dies taten.
Waschplätze und Duschen fortan bei allen Wasserstellen


Außerdem war diese Handlung auch eine Inspiration für ihn und das ganze Team dazu, in den von Menschen für Menschen gebauten Wasserstellen zusätzlich Waschplätze und Duschen einzurichten. Dies hat dazu beigetragen, die Hygiene und den Zugang zu sanitären Einrichtungen in all unseren Projektgebieten zu verbessern.
Dr. Asnake Worku, gelernter Arzt, ist seit mehr als 20 Jahren für die Stiftung in Äthiopien tätig. Er fing im „Mettu Karl Krankenhaus“ als medizinischer Koordinator für Menschen für Menschen an, arbeitete später in verschiedenen Positionen im Project Coordination Office (PCO) und ist heute stellvertretender Landesrepräsentant.

„Unser erstes Menschen für Menschen-Büro befand sich bis 1986 in der Münchner Fußgängerzone, gleich neben dem Kaufhaus Oberpollinger nähe Karlstor. Die Chefin eines großen Versandhauskonzerns hatte uns im Obergeschoss eines alten Gebäudes kostenlos einige Büroräume überlassen. Die Einrichtung war karg, der Boden schief und der Weg zur Toilette war gefühlt einen halben Kilometer lang.
Doch unsere damals noch kleine Sechs-Personen-MfM-Familie fühlte sich dort wohl. Im Sommer klangen die Lieder der manchmal zu lauten Straßensänger und Straßensängerinnen in unser Büro herauf, und wenn Karlheinz Böhm wieder einmal im Büro war und telefonierte, tippte ich meine Briefe in der kleinen Küche, um ihn mit dem Geklapper meiner IBM-Kugelkopfschreibmaschine nicht zu stören. Die Buchhaltung war mit der Spenderbetreuung in einem Zwischengang zuhause und unser Einkäufer hatte nur einen großen langen Packtisch als Arbeitsplatz.
Unser zweites, bereits wesentlich größeres Büro befand sich in einem geräumigen Kellergeschoss am Sendlinger Tor. Jede der Abteilungen, Spenderbetreuung und Buchhaltung, Einkauf und Transporte sowie Sekretariat, verfügte nun über einen eigenen Raum, wenngleich auch nicht in alle richtiges Tageslicht fiel. Neben der Kochnische befanden sich technische Errungenschaften wie ein Telex-Gerät, später Telefax, und ein wunderbarer alter und riesengroßer Schreibautomat der Firma Siemens.

Jetzt hatte auch Karlheinz Böhm sein eigenes Büro
Auch Karlheinz Böhm hatte jetzt sein eigenes Bürozimmer. Die Belegschaft bestand nun schon aus acht Personen in Voll- und Teilzeit. Wir hatten eine kleine Kammer als Lagerraum und bei einem Einbruch in unser Büro wurde zwar die Spendenkasse verschont, ein gerade erst angeschaffter, topmoderner Laptop aber gestohlen.
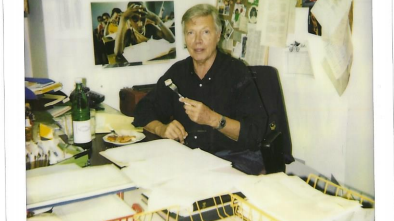

Karlheinz Böhm beim Weißwurstfrühstück im Büro in der Nussbaumstraße – und beim Geschirrspülen
Unser drittes Büro in der Akademiestraße an der Grenze zum trendigen Schwabing, das wir Mitte der 90er Jahre bezogen, befand sich zwischen Siegestor, der imposanten Kunstakademie und dem Münchner Traditionskino ARRI. Es war nicht wesentlich größer als das vorherige Kellerbüro, aber die Räume erstreckten sich elegant über zwei Ebenen und hatten alle große, atelierartige Fenster.
Hinten im Hof befand sich ein kleiner Garten samt Terrasse, die zum beliebten Sommerarbeitsplatz wurde, bevor man sich nach Feierabend ins Schwabinger Nachtleben stürzen konnte. Die Angestelltenzahl stieg auf etwa zehn, eine eigene PR-Abteilung wurde aufgebaut, alle Angestellten konnten mittlerweile an einem modernen PC arbeiten und das moderne, große Fax- und Kopiergerät im Vorraum bullerte wie die Klimaanlage eines 5-Sterne-Hotels.
Mit der Jahrtausendwende war auch dieses Büro zu klein geworden, und die Stiftung zog mit Sack und Pack in die Brienner Straße zwischen Propyläen-Tor am Königsplatz und Stiglmaierplatz. Hier durften wir zwei Stockwerke beziehen, und als neue Erweiterung kam eine eigene IT-Abteilung und später ein Arbeitsteam für Entwicklungszusammenarbeit hinzu, mehr als 20 Angestellte arbeiten hier bis heute für Menschen für Menschen. Endlich genug Platz!

Grillfeste, aber auch die Nachricht vom Tod Karlheinz Böhms
Der Gartenplatz im Hof eignet sich wunderbar für die legendären Grillfeste, und haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende und auch äthiopische Gäste feiern dort gemeinsam – oder taten dies zumindest bis zur Pandemie. Anlässlich von Renovierungsarbeiten im Jahr 2010 zog ein Teil des Teams ins Vordergebäude, wo wir seitdem feste Büroräume innehaben. Leider ist dies auch das Büro, in dem unser Team vom Tod unseres Gründers Karlheinz Böhm im Jahr 2014 erfahren musste.
Im Jahr 2017 verließ ich die Stiftung, um meinen drei Enkeln mehr Betreuungszeit widmen zu können. Nun ist die Stiftung seit mehr als 20 Jahren in dem Gebäude ansässig und kann man mit Recht sagen: „Do samma dahoam…“
Die Symbolik von Toren
Mir fällt auf, dass sich die Büroräume von Menschen für Menschen immer in der Nähe von bekannten Münchner Toren befanden und befinden. Natürlich ist das ein Zufall, aber es lässt mich auch über die Symbolik von Toren nachdenken: Als Karlheinz Böhm im Jahr 1981 mit der Gründung von Menschen für Menschen ein neues Tor in ein für ihn neues Leben durchschritt, war das „Dahinter“ noch unbekannt. Heute wissen wir, dass dieser Schritt vielen, vielen Menschen in Äthiopien ein besseres Leben gebracht hat.
Ich bin dankbar, dass ich all die Jahre dabei sein durfte.“
Edeltraud Hörmann
war von Januar 1986 bis Juli 2017 bei MfM als Vorstandssekretärin tätig.

Mit seiner legendären Wette in der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ am 16. Mai 1981, startete Karlheinz Böhm einen Spendenaufruf, der in seiner Größe und Reichweite alle Erwartungen übertraf. Schon wenige Tage nach der Veranstaltung waren 1,2 Millionen D-Mark zusammengekommen.
Was viele jedoch nicht wissen: Böhms Initiative entstand so spontan, dass es zum Zeitpunkt der Wette noch gar kein Bankkonto gab, wohin die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Spende schicken konnten. Der Schauspieler improvisierte kurzerhand und schlug vor, dass die Spenden an die jeweiligen Präsidialämter in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen sollten

Wäschekörbeweise Briefe mit 1-Mark-Stücken
Dem Vernehmen nach gingen in den folgenden Tagen nach der Sendung ganze Wäschekörbe voller Briefe beim Bonner Bundespräsidialamt ein, in die 1-Mark-Stücke eingeklebt waren. Schnell wurde ein Konto eingerichtet und die Spendeneingänge ordnungsgemäß dorthin verbucht, ehe im September 1981 offiziell der Verein „Menschen für Menschen“ gegründet wurde und die Arbeit in Äthiopien begann.
Wie aber war es in der Zwischenzeit zu diesem Namen gekommen? Nun, unter den zahlreichen Zuschriften, die die bemitleidenswerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespräsidialamtes tagelang abarbeiten mussten, befand sich auch dieser Brief von Edith Kadelburg aus Erlangen:
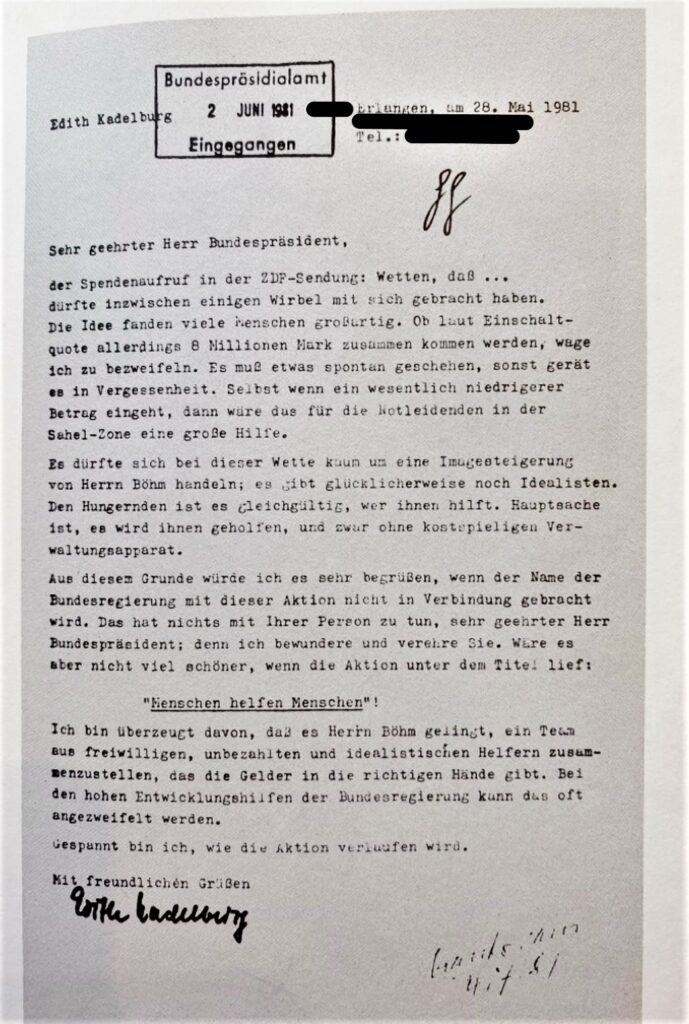
Der Vorschlag, die Spendenaktion unter dem Titel „Menschen helfen Menschen“ weiterzuführen, erreichte Karlheinz Böhm und gefiel ihm so gut, dass er ihn in leicht abgewandelter Form übernahm: Menschen für Menschen! Frau Kadelburg hatte – ohne sich dessen bewusst zu sein – für den heute berühmten Namen der Stiftung gesorgt.
Ihre Tochter Ines Kadelburg erinnert sich:
„Damals habe ich nicht mehr bei meinen Eltern in Erlangen gewohnt, aber kurz nach der „Wetten, dass…?“-Show, die ich nicht sehen konnte, rief meine Mutter mich an, erzählte von Karlheinz Böhms Wette, und wie viel er damit gerade ins Rollen brachte.
Meine Eltern waren beruflich und privat immer viel gereist und auch in Afrika gewesen, was meine Mutter nachhaltig beeindruckt hatte.
Außerdem war meine Mutter immer sehr spontan, demnach kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich einfach hingesetzt und den Brief ans Bundespräsidialamt geschrieben hat, um ihre Gedanken zu teilen. Den Brief selbst erwähnte sie mir gegenüber aber gar nicht – zwischen der vielen Geschäftspost erschien er ihr wohl nicht erwähnenswert.

Karlheinz Böhm erfährt vom plötzlichen Tod Frau Kadelburgs
Ein Jahr später verstarb meine Mutter leider recht überraschend und ich fuhr zurück in meine Heimatstadt, um mich um alles zu kümmern. An einem Freitag haben wir dann meine Mutter beerdigt. Just einen Tag später, an einem Samstagmorgen, klingelte in meinem Elternhaus das Telefon. Ich ging ran – und hatte Karlheinz Böhm am Apparat.
Dieser wusste natürlich noch nichts vom Tod meiner Mutter, der ihm sehr, sehr leidtat. Er sprach mich auf ihren Brief an das Bundespräsidialamt an, und da ich diesen bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, las er ihn mir laut am Telefon vor.
Karlheinz Böhm fragte mich, ob meine Mutter ein Copyright auf den Namen „Menschen helfen Menschen“ beansprucht hätte, denn der Namensvorschlag hätte ihm sofort gefallen und er würde ihn gerne für seine neu gegründete Organisation verwenden. Ich war mir sicher, dass meine Mutter bestimmt nichts dagegen gehabt hätte. Ganz im Gegenteil, sie hätte sich sehr gefreut, dass ihr Brief wirklich dort angekommen war, wo er hin sollte.
Das Telefon in Erlangen steht nicht mehr still
Kurz darauf wurde der Brief dann auch in dem von Karlheinz Böhm veröffentlichten Buch „NAGAYA – Ein neues Dorf in Äthiopien“ abgedruckt, Karlheinz Böhm schickte mir davon dann auch einige Exemplare zu.
In den nächsten Monaten und Jahren wohnte ich nicht in Erlangen und vermietete mein Elternhaus. Immer wieder gingen dort Anrufe von Leuten ein, die an Menschen für Menschen spenden wollten oder auch von Studierenden, die eine Forschungsarbeit über das Projekt von Karlheinz Böhm schrieben.
"Sie hätte sich über all das sehr gefreut"
Damals gab es ja noch kein Internet, und viele Menschen, die das NAGAYA-Buch sahen, hatten darin unsere Adresse von dem Brief meiner Mutter gefunden und dachten, dass dies die Anschrift der Stiftung Menschen für Menschen sei. Die Mieter und Mieterinnen des Hauses, und auch ich, nachdem ich 1986 zurückgezogen bin, haben die Anruferinnen und Anrufer immer nach München verwiesen, wir hatten alle schon unseren Standard-Telefon-Spruch parat.
Dass der Brief meiner Mutter so weitreichende Folgen hatte, war – ähnlich wie Karlheinz Böhms Wette selber – kaum zu erwarten. Doch ich bin mir sicher, sie hätte sich über all das sehr gefreut.“ —
Protokoll: Charlotte Honnigfort

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen