
Kampf ums Überleben
Region: Agarfa
Die Dürre in Äthiopien stellt das Land vor eine große Herausforderung: Mehr als zehn Millionen Menschen sind auf Hilfslieferungen angewiesen – und die Zahl wird voraussichtlich noch steigen. Eine Notlage, die nur zu bewältigen ist, wenn Staat und Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Auch Menschen für Menschen beteiligt sich an der großangelegten Hilfsaktion. Langfristig aber schützt vor Hunger-Katastrophen nur eine weitsichtige und nachhaltige Entwicklungsarbeit.
Manchmal glaubt Ahmed Sirag, die Dürre verfolge ihn wie ein Fluch. Vor zwölf Jahren verdorrten seine Felder zum ersten Mal, das war noch in seiner Heimat, der Region Somali in Ostäthiopien. Ahmed, damals 27 Jahre alt, nahm seine Frau und seine Kinder und siedelte ins Landesinnere um, nach Oromia.

Nur zwei Jahre später versiegten die Brunnen in ihrer Gegend, wieder zog die Familie weiter. Jetzt ist Ahmed 39 Jahre alt – und kämpft abermals gegen den Hunger. „Diesmal können wir nicht weglaufen. Wohin sollten wir denn gehen?“
Äthiopien wird derzeit von der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten heimgesucht. In manchen Gegenden sind seit mehr als einem Jahr die Regenzeiten ausgefallen. Die Niederschläge, die es gab, reichten nicht, um Getreide und Gemüse zur Reife zu bringen. Eine Ernte nach der anderen fiel aus.
Die Folge: Aktuell sind mehr als zehn Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Eine Situation, die vor allem die Kinder gefährdet, da Mangelernährung zu Entwicklungsschäden führen kann. Und die Lage könnte sich zuspitzen: Das UN-Welternährungsprogramm rechnet mit bis zu 18 Millionen betroffenen Menschen im Laufe des Jahres 2016 – wenn es nicht ausreichend regnet.

Klimawandel als Fluchtursache
Als Grund für die Dürre gilt „El Niño“, ein Wetterphänomen, das weltweit für Turbulenzen sorgt. Es soll für Trockenheit in Ostafrika, Australien und Südostasien ebenso verantwortlich sein, wie für starken Regen in Südamerika. Dass die El Niño-Extreme heftiger werden, erklären Wissenschaftler mit dem Klimawandel. Und so lassen sich die aktuelle Dürre und die mit ihr verbundene Not am Horn von Afrika als Vorboten eines der künftig größten Probleme der Menschheit lesen: Migrationsforscher schätzen die Zahl der Menschen, die bis zum Jahr 2050 vor den Folgen des Klimawandels fliehen müssen, auf 50 bis 350 Millionen.“
Doch es mangelt ihnen nicht nur an Energie. Mais füllt den Magen, aber er liefert nicht alle Vitamine und Spurenelemente. „Als ich schwanger war, bin ich zur Gesundheitsstation, weil ich so schwach war“, erzählt Workenesch.
„Sie sagten, ich litte unter Blutarmut.“ Eine Folge von Eisenmangel – für Frauen in Äthiopien, die viele Kinder bekommen und keine abwechslungsreiche Kost zu sich nehmen, ist das eine alltägliche Diagnose. Zwar nimmt Workenesch nun Eisentabletten. „Aber immer noch fühle ich mich häufig schwindelig“, erzählt die Bäuerin, „alles dreht sich um mich herum.“
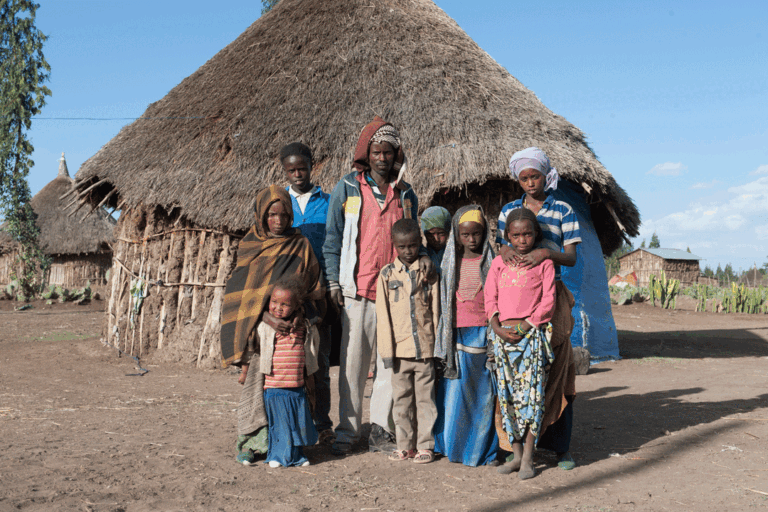
Schon heute leben allein in Äthiopien rund 550.000 Binnenflüchtlinge, die meisten sollen Klimaflüchtlinge sein. Nicht nur Flüchtlingsaktivisten schlagen Alarm: Nikolaus von Bomhard, Vorstandsvorsitzender des Münchner Rückversicherers Munich RE sagte unlängst in einem Interview mit dem „Spiegel“: „Der Klimawandel hat das Potenzial, zu einem Haupttreiber künftiger Wanderbewegungen zu werden.“ Ahmed Sirag ist ein hagerer Mann mit kantigen Zügen, der nicht viel mehr besitzt als die Kleidung, die er am Leib trägt. Er weiß nichts von der Debatte um den Klimawandel. Doch seine Familie und er waren schon „Klimaflüchtlinge“ als dieser Begriff in Europa noch kaum bekannt war.
Damals, vor zwölf Jahren, flohen sie vor der ständigen Dürre in Ostäthiopien. Wie viele tausend Familien marschierten sie los, westwärts. Dahin, wo die Böden noch etwas hergaben. Sie kamen in einem Flüchtlingslager unter, doch zwei Jahre später wurde das Brunnenwasser knapp, also wurden sie umgesiedelt.

„Jede Familie erhielt einen Hektar Land“, erzählt er. Es war schon damals wenig fruchtbares Land, das nicht viel hergab, aber es reichte zum Überleben. Doch seit der Regen ausblieb, stehen nur noch ein paar Disteln auf seinem Feld. Zuletzt versiegte die Wasserstelle im Dorf. „Jetzt müssen wir für sauberes Wasser sieben Kilometer weit laufen“, sagt Ahmed. „Wir wissen aber nie, ob es dann gerade Wasser gibt.“
Fragiler Aufschwung
Dürre und Hunger in Äthiopien: Das weckt Erinnerungen. Von 1983 bis 1985 erlebte das Land das größte Hungersterben Afrikas der vergangenen Jahrzehnte. Die Zahl der Opfer wird auf eine halbe Million bis eine Million geschätzt. Fotos von Sterbenden gingen um die Welt und prägen das Bild von Äthiopien als „Hungerland“ bis heute.
Doch seither hat sich eigentlich viel getan: Die Wirtschaft des Landes wächst im Rekordtempo und hat Äthiopien den Ruf als „Afrikanischer Tiger“ eingebracht. Doch mit jeder neuen Dürre zeigt sich, wie fragil der Aufschwung ist. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind nach wie vor Kleinbauern, die von dem leben, was ihr Acker hergibt. Rücklagen für schlechte Zeiten haben sie nie bilden können. Jeder Ernteausfall bedroht schon bald ihre Existenz.
Ahmed Sirag winkt uns in seine ärmliche Rundhütte. Rostige Töpfe und ein Bündel Holz liegen herum. Hinter einer Plane: die Strohmatte der Eltern. Die Kinder schlafen auf dem Lehmboden. „Dort lagerte immer unser Getreide“, sagt Ahmed und deutet auf die nackte Wand. 300 Kilo Weizen und Gerste erntete er in guten Jahren. Dazu ein paar Kilo Mais und ein wenig Gemüse. Ein mannshoher Stapel Säcke, der die Familie bis zur nächsten Ernte ernährte. Morgens gab es Gerstenbrei, mittags und abends „Injerra“, das traditionelle Fladenbrot aus Sauerteig.
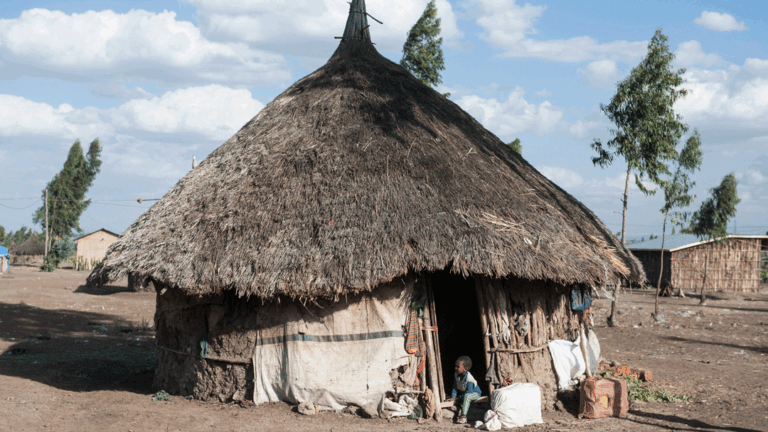
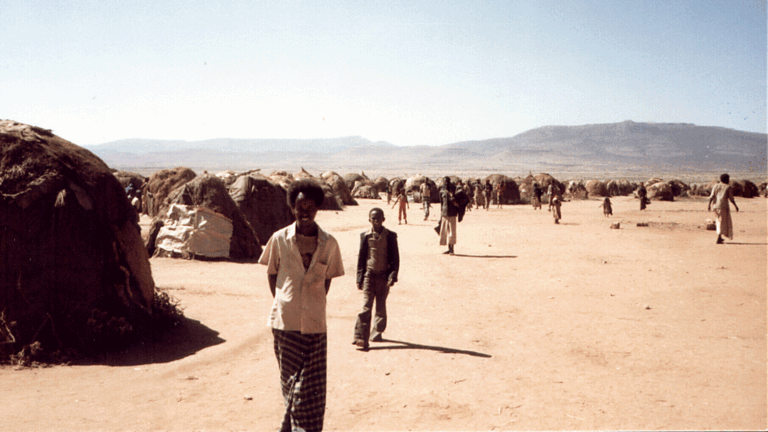
Dann blieb der Regen aus. Erst die „Kleine Regenzeit“ im Februar und März 2015, dann auch noch die „Große Regenzeit“ von Juli bis September. Der Stapel aus Getreidesäcken schmolz schnell zusammen. Dann kamen die Tiere an die Reihe: Vier Ochsen besaß die Familie. Je magerer sie wurden, und je mehr Menschen ihr Vieh verkauften, desto schlechter wurde der Preis. Doch am Ende blieb auch Ahmed Sirag keine Wahl. Er führte einen Ochsen nach dem anderen zum Markt. Ein einziger ist ihm geblieben. „Wenn ich den auch verkaufe – wie soll ich dann pflügen, wenn der Regen kommt?“

Die Nothilfe läuft
Dann kam Hilfe: Aufgrund zusätzlich erhaltener Spenden konnte Menschen für Menschen den Radius der seit Herbst 2015 laufenden Nothilfe auch auf Sheneka ausweiten: Seit Januar 2016 erhalten nun auch Ahmed Sirag und seine Familie, wie die Mehrzahl der rund 7.000 Bewohner der Flüchtlingsgemeinde, Nahrungsmittelpakete: 15 Kilogramm Weizen, 1,5 Kilogramm Bohnen sowie 0,5 Liter Öl stehen einer Person im Monat zu.

Schwangere Frauen, stillende Mütter und Kleinkinder erhalten zusätzlich 4,5 Kilogramm Famix, ein proteinreiches Nahrungsergänzungsmittel. Insgesamt verteilt die Stiftung Lebensmittel an 32.500 Menschen
„Dank der Hilfe können meine Kinder wieder drei Mal am Tag essen“, sagt Ahmed Sirag. „Sie sind nicht mehr so kraftlos, das beruhigt mich.“ Dürre und Nothilfe zeigen einmal mehr, wie wichtig die Arbeit von Menschen für Menschen ist. Durch die von der Stiftung initiierten Maßnahmen in elf langfristig angelegten Projektregionen werden Kleinbauern in die Lage versetzt, bessere Erträge zu erwirtschaften, Krankheiten zu besiegen oder durch eine bessere Bildung und Ausbildung neue Einkommensquellen zu entwickeln.
Viele erreichen so ein wenig Sicherheit und können etwaige Ernteausfälle besser verkraften. Langfristig helfen die Projekte der Stiftung, Menschen in Äthiopien ein Leben in Würde zu führen – und beugen auf diese Weise Fluchtursachen vor. Im Frühjahr 2016 hat es geregnet.

Leichte Hoffnung kommt auf. Inwieweit die Niederschläge zu einer Verbesserung der Lage führen werden, bleibt abzuwarten, denn die Nachwirkungen der langen Trockenheit sind erheblich. Alle hoffen nun auf den großen Regen im Juli. Und wenn auch der ausfällt? Ahmed Sirag breitet die Arme aus, die Handflächen nach oben gerichtet. Am Himmel ziehen ein paar weiße Wolken vorbei. „Der Regen wird kommen“, sagt er. „Wenn Gott es will.“
„Vor einigen Monaten nahmen wir Zeichen von Unterernährung, vor allem bei Kindern in der Region wahr. Seit wir Lebensmittel und Ergänzungsnahrung verteilen, ist das größtenteils vorbei.“
Tewelde Gebre Kidan (52), Koordinator des Nothilfeprogramms von Menschen für Menschen in Agarfa.